„Hegel bemerkte irgendwo, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.“
– Karl Marx in „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“ –
Wir treffen uns mit Mirko Broll vom Frankfurter Institut für Sozialforschung (IfS), um über unsere Demokratie zu sprechen.
Hallo Mirko! Erzähl uns doch mal was über dich und deine Arbeit beim Institut für Sozialforschung.
Ich bin Referent für Öffentlichkeitsarbeit, beschäftige mich damit, das, was wir hier am Institut für Sozialforschung machen, nach außen zu tragen. Also sei es jetzt Broschüren oder Plakate zu erstellen, große Konferenzen, Vorträge und Workshops zu bewerben oder auch Veranstaltungen, die für die breite Öffentlichkeit geöffnet sind.
Wen wollt ihr mit diesen Angeboten erreichen? Habt ihr eine bestimmte Zielgruppe?
Wir haben zum Beispiel unsere zentrale Publikation, das Perspektiven- bzw. Forschungspapier, das wir im 100-jährigen Jubiläum veröffentlicht haben. Damit wollten wir reflektieren, wofür das IfS in der Geschichte stand, wofür es heute stehen kann und warum es wichtig ist, auch einen Ort der kritischen Theorie hier in Frankfurt oder in Deutschland zu haben. Das hat sich vor allem an Studierende gerichtet, aber auch an Forschende und Wissenschaftler*innen aus anderen Ländern. Wir haben das mittlerweile in fünf Sprachen übersetzt.
Uns ist es wichtig, in einen internationalen Dialog und Diskussionprozess mit kritischen Theorien weltweit zu treten. Wir wollen nicht nur aus Deutschland auf Deutschland gucken, sondern alles in globalen Zusammenhängen sehen. In den letzten Jahren haben wir ganz starke Beziehungen zu lateinamerikanischen Forschenden und Institutionen aufgebaut, vor allen Dingen in Argentinien. Unter dem – kann man sagen – faschistischen Regime von Milei finden jetzt gerade ganz andere Kämpfe um Demokratie statt.
Also sowohl auf der Straße – es gibt ja große Demonstrationen und auch Streikbewegungen dort – als auch in der Wissenschaft, weil dort versucht wird, die kritische Wissenschaft rauszudrängen, und Instituten das Geld genommen wird. Deswegen ist es uns wichtig, die Beziehungen zu stärken, die Leute öfter zu uns einzuladen und dieses Wissen, das sie dort erarbeiten, auch in unsere eigenen Überlegungen mit einzubeziehen.

Und wie genau können wir uns die Arbeit des IfS vorstellen?
Die meisten Forschungsprojekte hier am IfS haben einen empirischen Teil. In der Regel sind das qualitative Interviews, das heißt, unsere Mitarbeitenden gehen ins Feld, wie wir das sagen, interviewen Menschen und werten die Interviews dann aus. Insgesamt ist das IfS sehr interdisziplinär angelegt.
Wir haben hier Leute aus der Soziologie, aus der Philosophie, Leute mit einem sozialpsychologischen oder psychoanalytischen Background, Literaturwissenschaftlerinnen und Kunsttheoretiker. Hier kommt alles zusammen und das ist ja auch seit 100 Jahren das Bezeichnende für das Institut. Ganz am Anfang kamen hier die verschiedensten Denkerinnen und Denker zusammen, alle unter dem Dach der kritischen Theorie.
Ich habe ein Zitat rausgesucht, weil ich das ganz passend fand. Das ist von Max Horkheimer, einem der ersten Direktoren des IfS. Der hat damals im Jahr 1937 gesagt: „Kritische Theorie zielt nirgends bloß auf Vermehrung des Wissens als solchem ab, sondern auf die Emanzipation des Menschen aus versklavenden Verhältnissen.“ Und das ist quasi das Anliegen kritischer Theorie in einem Satz. Ich würde sagen, da liegt auch ihr Ursprung. Von Anbeginn ist eine zentrale Frage, warum es nicht zu einer positiven Veränderung der Gesellschaft kommt, sondern sich auch Leute einer faschistischen Bewegung zuwenden, die vielleicht selbst negativ davon betroffen sein werden.
Ich glaube, die Verwunderung darüber ist eigentlich schon die Einsicht, dass die Gesellschaft, so wie sie gerade eingestellt ist, in die Katastrophe schlittert, wenn man nicht schon von der Katastrophe in der Gegenwart sprechen könnte. Und trotzdem machen die Menschen so mit ihren Verhaltensweisen und Praktiken weiter, wie sie es gewohnt sind. Es gibt zwar ein Bewusstsein darüber, dass es so nicht weitergehen kann, aber praktisch gesehen geht es trotzdem immer so weiter.
Das ist ein Thema, das das IfS auch immer schon beschäftigt hat. Warum machen Leute etwas, was eigentlich ihren eigenen rationalen Interessen widerspricht? Die psychoanalytische, sozialpsychologische Dimension hilft in der Theoriebildung zu verstehen, dass der Anschluss an faschistische Bewegungen einen psychischen Lustgewinn für die Menschen hatte, der aber ökonomisch gesehen eigentlich irrational war.
Das hat Erich Fromm, ein Sozialpsychologe hier am IfS, als autoritären Charakter bzw. „Radfahrersyndrom“ beschrieben. Also wenn man sich jemanden vorstellt, der auf dem Fahrrad sitzt und nach oben hin buckelt, sich also den bestehenden Autoritäten beugt, aber nach unten tritt, sozusagen gegen die Leute, die noch eine Stufe unter ihm sind. Denen soll es schlechter gehen, die sollen bestraft werden, aber nach oben gibt es keine Rebellion.
Warum ist es wichtig, mit genau solchen Perspektiven in die Öffentlichkeit zu gehen?
Wir versuchen immer wieder, mit unseren Veranstaltungen in die Öffentlichkeit zu gehen, um auf solche Themen hinzuweisen. Zum Beispiel finden zwei Veranstaltungen zum Thema Autoritarismus statt: Ende April eine Konferenz hier im Studierendenhaus und im Herbst eine Reihe im Mousonturm, die wir planen. Wir denken, dass der Blick aus dem Globalen Süden, zum Beispiel auch hier wieder aus Argentinien, aus einer ganz anderen Perspektive als unserer, dabei helfen kann, auch die Gesellschaft hier bei uns zu verstehen.
Steigt das Interesse an solchen Events im Moment?
Ja, ich finde schon. Unsere Veranstaltungen sind sehr, sehr gut besucht, auch hier bei uns im Studierendenhaus, was quasi auch ein Ort der Demokratie ist. Das wurde der Studierendenschaft vom damaligen Institutsdirektor und Rektor der Goethe-Universität Max Horkheimer als Ort des Austausches übergeben, weil er sagte, freie Räume sind wichtig, um nachdenken zu können, um sich organisieren zu können.
Im Jahr 2023 haben wir dort zum hundertjährigen Jubiläum der ersten Marxistischen Arbeitswoche 1923, einem ersten Theorieseminar des gerade gegründeten IfS, auch eine solche veranstaltet, weil wir an verschiedene Ereignisse aus diesem Zeitraum erinnern wollten. Dieses Mal aber nicht nur als kleiner Theoriezirkel wie vor hundert Jahren, sondern als Großveranstaltung. Da waren über 900 Leute hier und jede Veranstaltung war extrem gut besucht. Es kamen nicht nur Studierende, sondern Leute aus dem ganzen Bundesgebiet und haben die Veranstaltung besucht.
Wow, das klingt sehr spannend. Gerade in einer Zeit, in der gesellschaftlicher Wandel vor allem aus der Mitte und von unten kommen sollte, interessieren sich viele für eure Arbeit, oder?
Es fällt schon auf, dass es ein Bedürfnis nach kritischer Theorie gibt. Ich würde aber gleichzeitig auch sagen, dass kritische Theorie allein noch keine positive gesellschaftliche Veränderung voranbringen kann. Das muss von den Leuten selbst kommen. Wir können nicht als Avantgarde, als Vordenkerinstitutionen, hingehen und sagen: „So funktioniert’s, so werden wir zu einer besseren Gesellschaft.“ Wir können nur aufnehmen, was es sowieso schon gibt. Welche Demonstrationen es schon gibt, welche Bewegungen der Transformation es weltweit schon gibt. Und dann versuchen, die ein bisschen voranzubringen, aber auch kritisch zu reflektieren und zu zeigen, wo etwas vielleicht auch scheitert und wo man etwas verändern kann, damit wir Gesellschaft zum Positiven verändern.
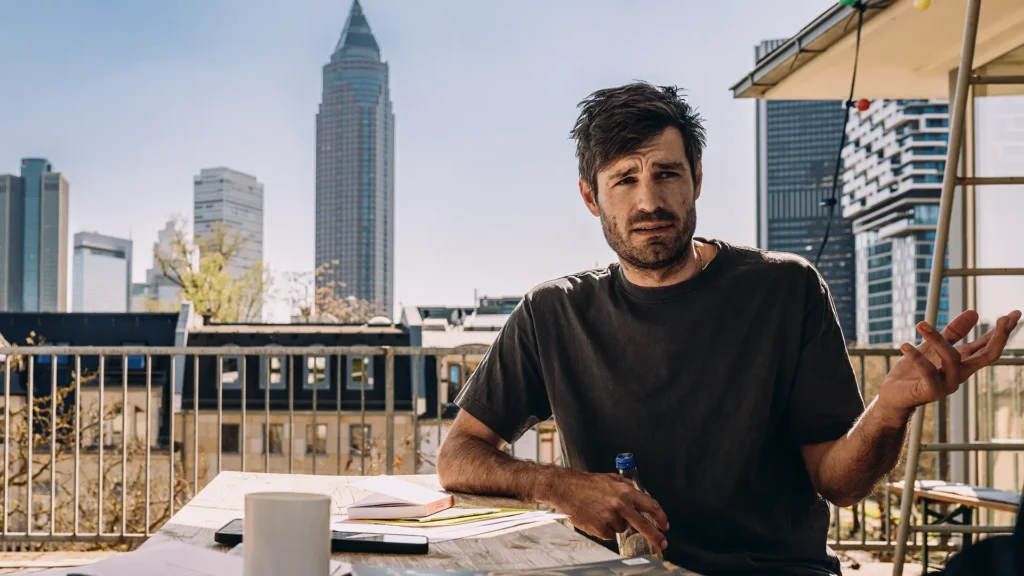
Denn genau das fehlt ja oft: dass überhaupt jemand anfängt, Dinge zu hinterfragen. Es muss nicht immer direkt zum Ziel führen – aber Denken ist der erste und wichtigste Schritt.
Ja, das würde ich auch sagen. Also die Bewusstwerdung darüber, dass das, wie es ist, nicht so sein müsste und man es auch anders gestalten könnte, und dass überhaupt was falsch läuft. Ich glaube, das Bewusstsein ist bei vielen Leuten schon da, auch bei denen, die keinen Bezug zu kritischer Theorie oder zur Uni haben. Die merken, irgendwas läuft falsch hier, und ich finde, das ist schon mal der erste Schritt. Damit es zu einer Veränderung kommt, wäre dann der zweite Schritt, dass es dann auch zu irgendeiner Form von aktivem Handeln kommt.
Wir verstehen uns hier nicht als irgendeine Art von Elfenbeinturm, wo das reine und das wahre Wissen entsteht, sondern sind tatsächlich immer in Kontakt und Auseinandersetzung mit den Leuten da draußen.
Wie macht ihr das?
Wir laden Leute aus der Praxis ein. Oder wir kooperieren mit NGOs oder mit politischen Bewegungen, die es schon gibt, um dann auch diese Perspektiven mit einzuholen.
Und natürlich haben wir durch unsere empirischen Sozialforschungsprojekte auch den Draht und den Kontakt nach draußen.
Was ist denn der Antrieb für eure Arbeit? Wo seht ihr Hoffnung?
Das Gebäude, in dem wir heute sitzen, wurde 1951 errichtet. Adorno und Horkheimer sind damals aus dem amerikanischen Exil wiedergekommen, sind also zurückgekehrt in das Land der Täter, vor denen sie fliehen mussten, was eine total unwahrscheinliche Entscheidung war. Diese Entscheidung war aber verbunden mit der Hoffnung, dass sich etwas zum Besseren bewegen lässt. Vor allem Adorno hat sehr starke politische Aufklärung betrieben, zum Beispiel in vielen Radio-Interviews.
Er wird oft als derjenige beschrieben, der schwierige Texte geschrieben hat. Die sind auch nicht leicht, aber er hat noch eine andere Seite gehabt. Er ist ins Radio gegangen und hat in relativ einfacher Sprache einstündige oder noch längere Vorträge gehalten. Die kann man heute noch bei YouTube und in den Radioarchiven finden und die hatten ein großes Publikum. Da haben ganz viele Leute den Vorträgen von ihm im Radio zugehört, wo es darum geht, was Aufarbeitung der Vergangenheit oder Erziehung zur Mündigkeit bedeutet. Er hat zum Beispiel auch einen Vortrag gehalten, der heute noch super aktuell ist: „Aspekte des neuen Rechtsradikalismus“. Da geht es um das Wiedererstarken der Rechten in den 60er-Jahren.
Es gab damals eben nicht nur die linken 68er, sondern auch rechte Bewegungen. Und das, was er da gesagt hat, und die gesellschaftliche Notwendigkeit von Aufklärung sind heute nicht weniger aktuell. Und genau deswegen versuchen wir, Vorträge zu organisieren, solche Veranstaltungsreihen wie jetzt im Herbst, wo es eben um diese Frage des Autoritarismus und Faschismus geht. Da beleuchten wir nicht nur die alten Theorien, sondern zeigen, wie die Gestalt des gegenwärtigen Faschismus aussieht.
Ist das nicht manchmal frustrierend, dass wir nicht aus der Geschichte lernen?
Ich glaube, wenn wir die Hoffnung nicht hätten, dass man irgendwas bewegen könnte, könnten wir es auch sein lassen. Worin ich im Moment eine besondere Gefahr sehe, ist, dass nicht nur die AfD so stark wird, sondern dass viele Parteien das Spiel mitspielen und sich komplett auf die Themen der AfD eingelassen haben. Das ist jetzt vielleicht eher meine persönliche politische Einschätzung, aber es gibt eine Gesamtverschiebung des Diskurses in der gesellschaftlichen Debatte.
Haben wir ein Medienproblem, das die Situation noch verschärft?
Ja, total. Also wenn man jetzt Twitter oder X von Musk nimmt, das hat schon immer auf der rechten Seite funktioniert, weil es ja immer ganz kurze, knappe Tweets sind, die oft vereinfachend und auch provokant formuliert sind und dadurch eine besonders hohe Reichweite erfahren.
Es ist quasi eine Parallelöffentlichkeit geworden aus Leuten, die vielleicht auch gar keine anderen Informationsquellen mehr haben, sondern sich nur noch komplett über X informieren. Ehrlich gesagt, ich bin in meiner Funktion als Öffentlichkeitsarbeitsreferent hier am IfS natürlich auch oft in den sozialen Medien unterwegs, weil wir auch Kanäle auf diesen Plattformen haben. Ende letzten Jahres haben wir uns aber auch bei X abgemeldet, weil der Diskurs immer menschenfeindlicher wurde. Es wurde immer propagandistischer und immer voller von Ressentiments und Fake News und so weiter. Deswegen haben wir uns von dort verabschiedet, wie viele Unis, Vereine und Unternehmen in Deutschland auch.
Siehst du diesen Schwenk in Amerika als eine Gefahr für unsere Demokratie?
Ich glaube, was ein Problem für die Demokratie sein könnte, ist, wenn man sich als normaler Bürger oder Bürgerin zu sehr auf dieses Denken in nationalen Kategorien einlässt. Als Beispiel: Ich als Person aus Frankfurt mit dieser oder jener gesellschaftlichen Stellung habe mehr Gemeinsamkeiten mit jemandem in den USA oder woanders auf der Welt, der in einer ähnlichen sozialen Lage ist, als mit einem der Top-Milliardäre in Deutschland.
Wir dürfen uns vom Nationalismus nicht vereinnahmen lassen und müssen unsere Kategorien des Denkens kritisch hinterfragen. Es ist eine große Gefahr, Informationen, ohne sie zu hinterfragen, einfach so zu übernehmen. Ich finde, nicht nur die Wissenschaft, sondern auch der Journalismus hat die Aufgabe, kritische Nachfragen zu stellen und Hintergründe zu erhellen und einzuordnen.
Dass der Frankfurter genauso viel zu tun hat mit irgendeinem Typ in Paris oder London, der auch gerade die Rolling Stones hört – das war ja mal ein verbindendes Element quer durch alle Nationen. Was hat Musik, oder generell Kultur, mit Demokratie zu tun?
Dieser Internationalismus, wenn man das so nennen kann, der ist ein wichtiges Anliegen, was sich auch durch die Geschichte des IfS zieht und immer schon Kern von emanzipatorischen Bewegungen war. Politisch gesehen ist das auch wichtiger denn je. Wir sollten nicht nur in diesen nationalen Kategorien denken, sondern auch über die Grenzen hinaus Verbindungen und Verknüpfungen schaffen.
Kannst du dich daran erinnern, wann kritische Theorie für dich so an Bedeutung gewonnen hat?
Ich komme aus der Nähe von Bielefeld und hab mich dort schon in der Schulzeit mit Freundinnen und Freunden in Initiativen gegen Rechts zusammengetan, um was gegen Faschismus und Nationalismus zu tun. Schon damals haben wir uns mit Texten von den frühen Vertretern der kritischen Theorie beschäftigt. Wir haben natürlich längst nicht alles verstanden, aber es gab immer einzelne Fragmente von Marcuse, Adorno oder Benjamin, die uns beeindruckt haben. Wir dachten: „Wow, da sagt jemand, dass die Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, eigentlich nicht sein müsste und dass es ein Leben jenseits von Ausbeutung und Herrschaft geben könnte.“
Uns wurde klar, dass die Gesellschaft menschenfreundlicher und zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse eingerichtet sein könnte und nicht den menschlichen Bedürfnissen entgegengesetzt. Das war sozusagen mein persönlicher, politischer Ausgangspunkt, mich mit diesen Theoretikern oder auch mit politischen Fragen zu beschäftigen. Und das war auch der Grund, warum ich mich dann dafür entschieden habe, unter anderem Soziologie zu studieren, aber auch Philosophie und Politikwissenschaften. Ich habe das dann in München gemacht, weil ich aufgrund des Zivildienstes da gelandet bin. Da gab es aber gar nicht so viele Angebote zur kritischen Theorie, die musste man in den einzelnen Seminaren fast schon einfordern.
Glücklicherweise kam dann Stephan Lessenich als Professor nach München und hat internationale kritische Theorien mit reingebracht. Ich war dann auch studentische Hilfskraft. Da haben wir uns mit Rassismus, Autoritarismus, Faschismus beschäftigt und auch lokale Netzwerke mit der Stadt und anderen Organisationen in München geknüpft.
Dann habe ich meine Doktorarbeit über Austeritätspolitik geschrieben, genauer gesagt Sparpolitik im Gesundheitswesen in Griechenland. Mein Forschungsthema in Griechenland waren einerseits die Sparmaßnahmen im öffentlichen Gesundheitssystem, andererseits aber auch die solidarischen, demokratischen Gegenbewegungen gegen diese Austeritätspolitik, wo Leute einfach ihr Schicksal in die Hand genommen haben und Strukturen aufgebaut haben, um Menschen unabhängig von Herkunft oder Erwerbsstatus medizinisch zu versorgen.
Sie haben gesagt: „Gesundheitsversorgung muss ein Recht sein für alle Menschen, egal wo sie herkommen, egal ob sie einen Job haben oder nicht.“ Und das haben sie auch politisch eingefordert. Die Situation ist immer noch nicht gut, aber diese Bewegung hat ein paar Verbesserungen erreicht. Das war mein Dissertationsthema. Und mit dem Abschluss habe ich mich dann hier beworben auf die Stelle und kam zum IfS nach Frankfurt.

Und, schön hier?
München ist tatsächlich ein bisschen schöner, würde ich sagen. Aber in München gab es auch ganz viele Probleme und Sachen, die mir gar nicht gefallen haben.
Aber um das Ganze nochmal ein bisschen aufs IfS zu bringen: In München war es immer viel schwieriger, zum Beispiel politische Veranstaltungen zu organisieren. Es gibt viel weniger öffentliche Räume in München, wo man so etwas veranstalten kann. Hier in Frankfurt haben wir einerseits die Uni, die ein bisschen offener ist, andererseits gibt es das Studierendenhaus, das große Räumlichkeiten für Veranstaltungen von uns bietet. Generell ist die Stadtöffentlichkeit in Frankfurt ein bisschen offener für Fragen der Demokratisierung, Transformation, Solidarität usw., finde ich. Ich denke, nicht zuletzt aufgrund des IfS, also des Instituts.
Lass uns mal von Frankfurt auf ganz Deutschland switchen: Wenn du eine Maßnahme frei wählen könntest, um das demokratische Bewusstsein in der Gesellschaft nachhaltig zu stärken, was würdest du machen?
Ich würde in eine Sozialpolitik investieren, die den Menschen einen gewissen ökonomischen Druck nimmt und Prekarität abwendet. Das ist die beste Maßnahme, um faschistischen, autoritären Einstellungen entgegenzuwirken.
Habt ihr am IfS einen Überblick, wie sich die Gesamtstimmung zu gewissen Themen wie Faschismus und Demokratie so ändert?
Eher nicht, weil wir tatsächlich gar nicht so viel quantitativ arbeiten. Wir versuchen, die verschiedenen Positionen in der Gesellschaft herauszufinden und darzustellen, aber es ist eben quantitativ nicht repräsentativ. Uns geht es eher um Fragen nach dem Wie und Warum, um analytische Fragen, warum Menschen Dinge so machen, wie sie sie machen. Wir wollen Zusammenhänge aufzeigen, während es anderen eher um quantitative Bestimmungen geht. Da wir uns aber mit anderen Forschungseinrichtungen gut austauschen, ergänzen sich diese zwei Ansätze ganz gut.
Was, würdest du sagen, war der größte Forschungserfolg des IfS?
Das ist schwierig, weil das immer ganz unterschiedliche Forschungen waren. Jedes Jahrzehnt oder die verschiedenen Phasen in der IfS-Geschichte waren alle unterschiedlich. Ich würde sagen, am Anfang war sicher ein großer Beitrag des IfS, empirisch zu zeigen, dass große Teile der Bevölkerung dazu neigen, autoritäre, faschistische Positionen zu teilen. Und ein großer Erfolg des IfS ist die Verbindung von philosophischen, soziologischen Überlegungen und Sozialpsychologie. Ich glaube, diese Verbindung macht das IfS besonders, weil es die gesellschaftliche und die historische Situation aus der individuellen und der gesellschaftlichen Ebene heraus analysiert.
Man muss nicht alles gerade pessimistisch sehen, dass nur noch alles nach rechts geht oder so. Das ist zwar der Fall, aber gleichzeitig wächst auch das Verlangen oder das Bedürfnis nach kritischer Auseinandersetzung mit der Welt.
Sehr spannend. Vielen Dank für das Gespräch und für das Pushen von kritischem Denken, Reflexion und Veränderung!




