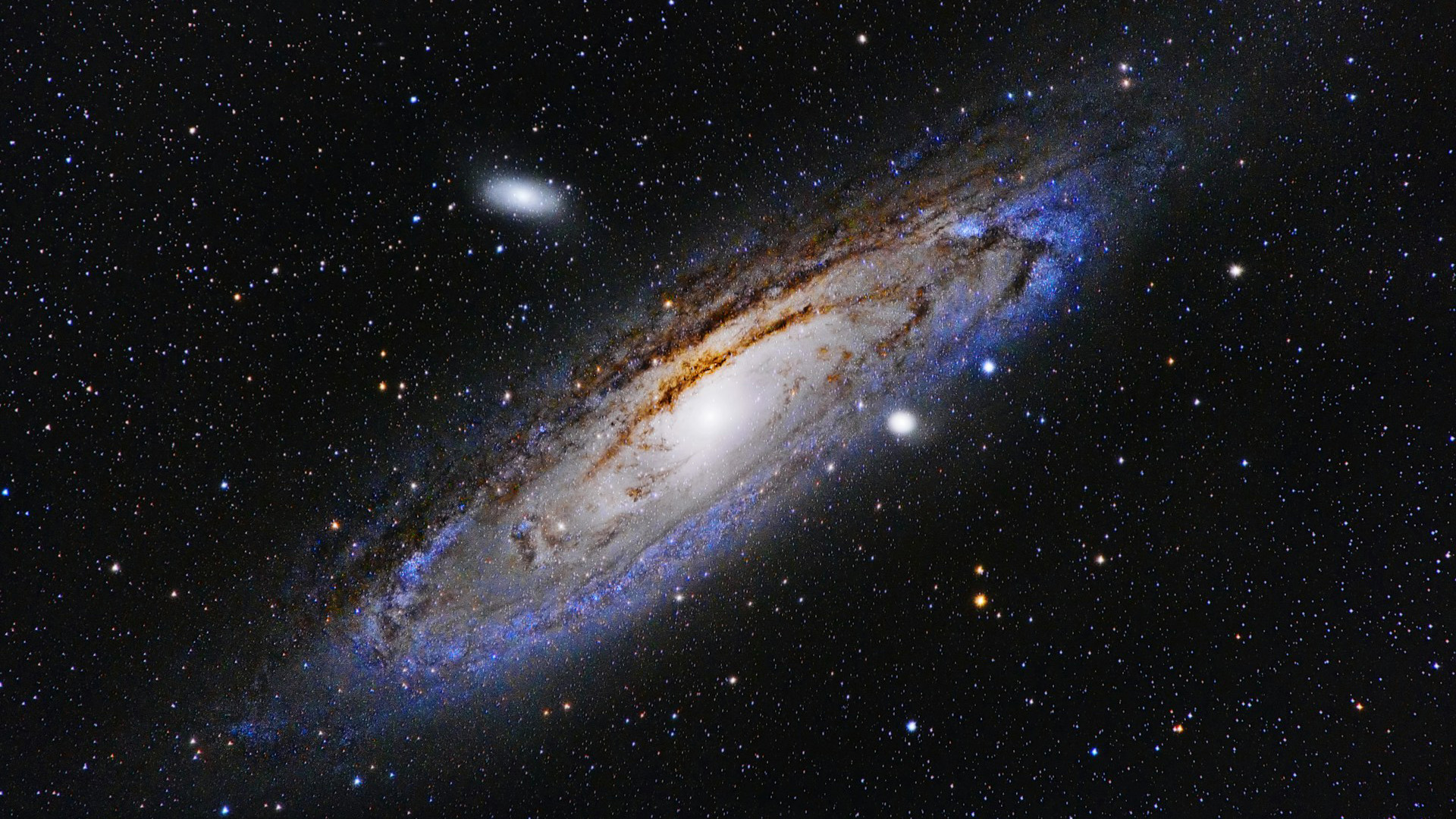Heute präsentiere ich euch nicht meine Top 5 Songs 2025. Zumindest nicht inhaltlich. Stattdessen geht es darum, wie ich diese Songs gefunden habe. Wie man überhaupt Musik findet, die einem gefällt in einer Welt, in der allein auf Spotify über 100 Millionen Tracks verfügbar sind. Und warum ich am Ende sogar eine Band höre, die ich eigentlich nicht mag.
Die Musiklandschaft ist chaotisch. Das war sie nicht immer.
Ein kurzer Blick zurück: Wie wir früher Musik entdeckten
Sehr viel früher, genauer gesagt 1877, existierte genau eine Aufnahme einer menschlichen Stimme, die sich wieder abspielen ließ. Thomas Edison gelang es mit seinem Phonographen, Schall auf walzenförmigen Tonträgern zu bannen. Zehn Jahre später, 1887, entwickelte Emil Berliner (aus Berlin) die erste Schallplatte. Und 1889 gilt als Geburtsjahr der Musikindustrie: Nach der Pariser Weltausstellung wurden Grammophone industriell gefertigt. Innerhalb weniger Jahre wurden Hunderttausende Tonträger und Abspielgeräte verkauft. Berühmte Musiker begannen, ihre Musik aufzunehmen, und verhalfen dem neuen Medium zu weltweitem Erfolg.
Erst Jahrzehnte später setzte sich die Vinyl-Schallplatte durch. PVC als Material ermöglichte bessere Klangqualität, längere Haltbarkeit und eine günstigere Massenproduktion. Die Unterhaltungsindustrie boomte, immer mehr Plattenfirmen entstanden. Einige von ihnen sollten sich in den kommenden Jahrzehnten zu den Major-Labels entwickeln. Lange Zeit entschieden sie, was dem Normalbürger zu Ohren kam: über Radio, Fernsehen und vor allem darüber, wer überhaupt auf Platte gepresst wurde.
Durch Fusionen und das Aufkaufen der Konkurrenz formierten sich Universal Music Group, Warner Music Group und Sony Music Entertainment zu den drei größten Playern der Branche mit einem Marktanteil von rund 70 Prozent. Vor dem Internet war es vergleichsweise einfach, Trends, Stars und Genres zu steuern, um Gewinne zu maximieren. Das grundlegende Problem blieb jedoch: Trends und Stars lassen sich nur bedingt konstruieren.
Talent-Scouts durchkämmten deshalb ständig lokale Szenen, Independent-Labels und Underground-Bewegungen auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Entlastung brachte die industrielle Fertigung von Musikkassetten. Sie waren deutlich günstiger als Schallplatten, ermöglichten Independent-Labels einen einfacheren Vertrieb und förderten die Entstehung von Mixtapes. Musik flog von Hörer zu Hörer und von Bands zu Labels.
Die erste große Krise der Musikindustrie setzte Ende der 1970er Jahre ein, als die Umsätze erstmals spürbar einbrachen. Die Einführung der CD brachte ab 1983 eine Erholung, und 1988 wurden erstmals mehr CDs als Schallplatten verkauft. Die zweite, heftigere Krise brachte das Internet.
Streaming-Dienste & Algorithmen: Fluch oder Chance?
Plötzlich konnten Konsumenten ohne Kuration durch Labels auf riesige Musikkataloge zugreifen. Illegale Downloads, Tauschbörsen und gebrannte CDs fluteten den Markt. Innerhalb von rund zehn Jahren halbierten sich die Umsätze der Major-Labels. Man reagierte mit Klagen gegen Download-Plattformen und mit eigenen digitalen Angeboten wie dem iTunes Store. 2011 überholten digitale Verkäufe erstmals die physischen Tonträger.
In den 2010ern kamen Streaming-Dienste wie Spotify, Deezer und Apple Music hinzu. Musik musste nicht mehr heruntergeladen werden, ein Abo reichte. Künstler wurden pro Stream vergütet. Man besaß keine Alben mehr, man lieh sie sich monatlich. Physische Medien verschwanden zunehmend aus dem Alltag und landeten im Keller oder im Müll.
Und hier sind wir heute: Die Major-Labels haben ihre Macht im Streaming-Zeitalter neu gefestigt. Durch enge Kooperationen mit Plattformen landen ihre Artists auf Startseiten, in Playlists und Feeds. Millionenbeträge fließen in Social-Media-Kampagnen und künstlich beschleunigte Hypes. Das Problem: Je schneller ein Hype entsteht, desto dramatischer fällt er oft wieder zusammen.
Ein frühes Beispiel dafür ist Gangnam Style von Psy: Das erste YouTube-Video mit über einer Milliarde Aufrufen. Der Song ging 2012 viral, befeuert durch Social Media und prominente Unterstützung. Psy selbst sagte später, dass er diesen Erfolg niemals wiederholen könne. Hierzulande verschwand Psy danach vollständig aus dem Mainstream.
Heute werden Hörer mit Songs geflutet, die oft nur ein Ziel haben: viral zu gehen. Dafür gibt es keine feste Formel, aber klare Trends. Songs werden kürzer, leichter verdaulich, der Refrain kommt früh. Das heißt nicht, dass sie schlecht sein müssen aber sie sind oft stärker für den Algorithmus gebaut als für die Ewigkeit.
Gleichzeitig war es nie einfacher, selbst Musik zu veröffentlichen. Es braucht kein Studio mehr, kein Label, kaum theoretische Kenntnisse. KI-generierte Musik kommt noch obendrauf. Die Vielfalt ist enorm, genauso wie die Überforderung. Für welchen Song gebe ich meine Lebenszeit aus? Alle Songs auf Spotify zu hören, würde über tausend Jahre dauern. Und ohne Qualitätskontrolle ist da eben auch viel Müll dabei.

Alle Wege führen nach Rom – oder zu neuer Musik
Meine fünf Top-Songs dieses Jahres habe ich auf komplett unterschiedliche Arten gefunden. Sich das bewusst zu machen, hilft mir zum Beispiel dabei, im Meer aus Musik nicht unterzugehen.
1. Ace Trumpets – Clipse
Clipse waren mir schon ein Begriff, bevor ihr neues Album Let God Sort ’Em Out erschien. Genervt von immer gleichen Trap-Beats stieß ich auf das Duo, als ich den Katalog der Neptunes durchforstete, die bereits Hell Hath No Fury produzierten. Lange war es ruhig um Clipse, etwa 15 Jahre gab es kein gemeinsames Album. Das Comeback-Rollout war dann perfekt orchestriert: Interviews, Magazin-Cover, Podcasts, Auftritte bei NPR Tiny Desk und COLORS. Als Rap- und Clipse-Fan flog mir der Song im Sturm der Algorithmen täglich entgegen. Kann auch mal ein Vorteil sein.
2. Bug – Fontaines D.C.
Gefunden im Line-up des Glastonbury Festivals. Es gibt Festivals, deren Auswahl ich blind vertraue. Auch wenn ich nicht vor Ort bin, höre ich mich durch Playlists oder schaue Konzertmitschnitte. Such dir ein Festival, das deinem Geschmack entspricht – garantiert sind dort Künstler dabei, von denen du noch nie gehört hast. Bonus-Tipp: Auch die Programme hipper Konzertlocations lohnen sich. Die Festhalle Frankfurt ist dabei meistens nicht gemeint.
3. Stepping On A Rake – Tropical Fuck Storm
Gefunden in Musikmagazinen. Zum Beispiel bei The Needle Drop, BrooklynVegan, DIY, VISIONS – und jetzt auch hier. Manchmal auch Pitchfork. Ganz selten Rolling Stone. Selbst schlechte Reviews können zu guter Musik führen. Bei Tropical Fuck Storm bin ich ehrlich gesagt am Bandnamen hängen geblieben. Hat sich gelohnt.
4. PIXELATED KISSES – Joji
Ich folge Joji. Er veröffentlicht einen neuen Song. Ich höre rein. Simple as that. Ein gutes Beispiel für einen Song, der mit seinen 1:50 Minuten vielleicht zu kurz ist aber davon im Streaming-Zeitalter profitiert. Kürzere Songs werden öfter abgespielt. Nur so konnte es PIXELATED KISSES überhaupt noch in meine Top 5 2025 schaffen, obwohl er erst im Oktober erschien.
5. Live Forever – Oasis
Ja. Oasis. Normalerweise meide ich die. Vielleicht auch zurecht. Würden Wonderwall und Don’t Look Back in Anger nach etwas schmecken, dann vermutlich nach Mehl: allgegenwärtig, staubig, irgendwie leer. Aber dann gibt es Live Forever. Die erste Oasis-Single in den UK-Top-Ten. In Deutschland schaffte sie es damals nicht einmal in die Top 100. Musikalisch nicht besonders komplex, aber ein guter Song. Ich musste über meinen Schatten springen, um das zu akzeptieren. Bisher ist es auch der einzige Oasis-Song, den ich höre – aber es hat sich gelohnt, die eigene Meinung einmal zu hinterfragen.
Fazit: wie finde ich neue Musik?
Musik zu finden heißt, Entscheidungen zu treffen. Wofür ich meine Zeit hergebe. Wem ich vertraue. Und wann ich bereit bin, meine eigene Meinung kurz auszuschalten. Manchmal bedeutet das, sich treiben zu lassen durch Playlists, Festival-Line-ups oder Magazintexte. Manchmal bedeutet es, gezielt zu suchen. Und manchmal eben auch, einen Song anzuhören, den man eigentlich schon abgeschrieben hatte. Nur um festzustellen, dass man sich geirrt hat. Vielleicht ist das der eigentliche Purpose hinter dem Musikfinden: nicht immer sofort zu wissen, was man mag, sondern offen genug zu bleiben, um es herauszufinden.