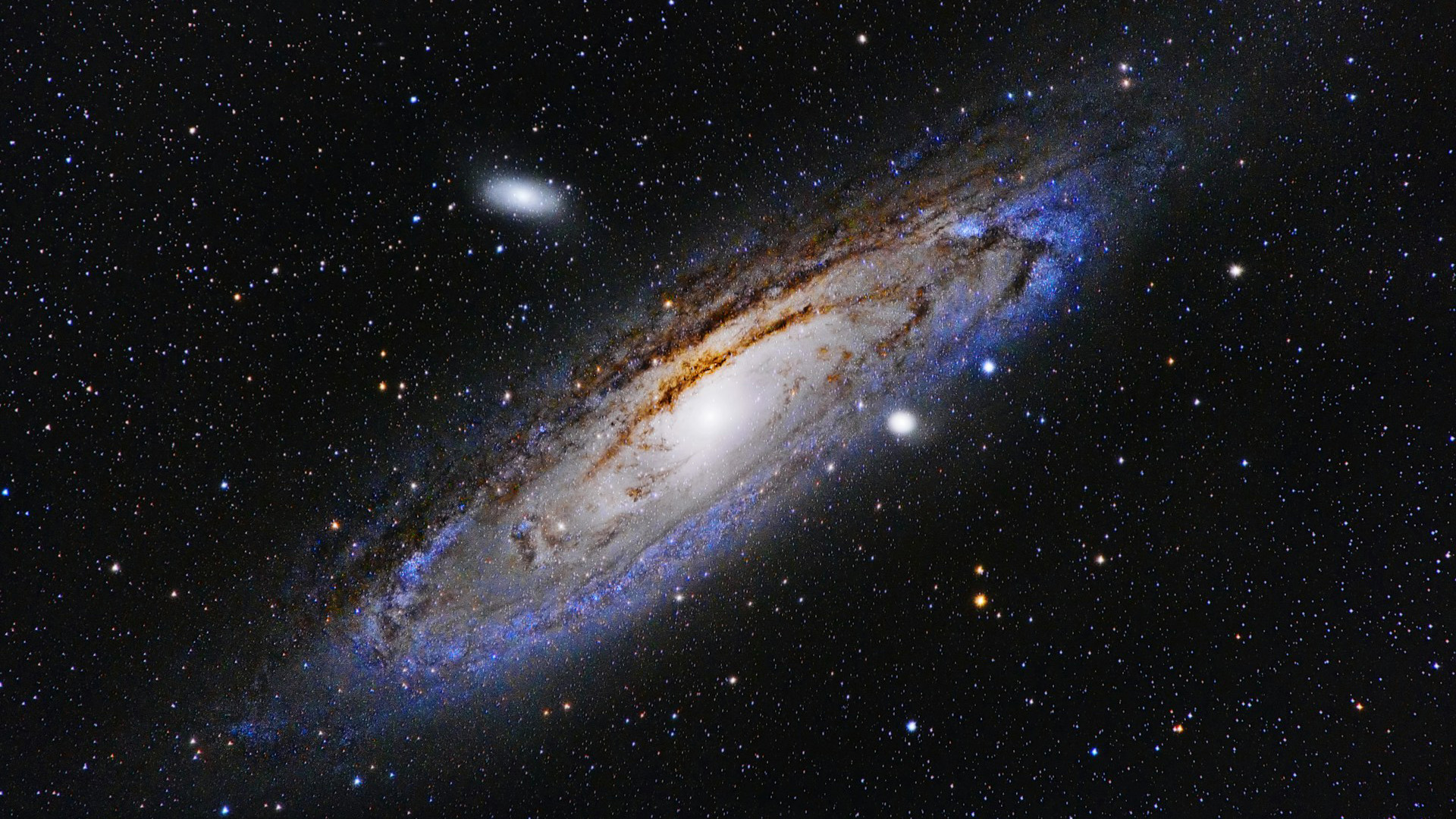Über die Kunst, strategisch fundierten Starrsinn zu pflegen.
Kaum etwas bekommen Gründer und Gründerinnen so im Überfluss wie gut gemeinte Ratschläge. Und hier kommt noch einer: Hört nicht drauf!
Heutzutage geht nichts ohne Collabs, entwickelt wird agil und man muss flexibel sein. Jederzeit. Bei allem, was man tut. Schon beim kollektiven Essen-Bestellen entwickeln manche Bürogemeinschaften eine magische Dynamik. Wenn Schwarmintelligenz auf Laktoseintoleranz und die Pizzabringdienst-Karte trifft, ergeben sich Zahlenkombinationen, die die Geheimnisse des Universums entschlüsseln helfen.
Alles wird gemeinsam entschieden, besprochen, diskutiert. Das ist gesellschaftlich gut. Wirtschaftlich kann daraus schnell ein Totalschaden werden.
Aber Moment mal: Ist es nicht gut, wenn man sich abspricht? Dinge neu bewertet, nachjustiert? Gerade weiche Ziele wie Zielgruppensegmentierung, Kommunikationsstrategien und Nutzenversprechen verlangen nach unqualifizierten Meinungsäußerungen. Sonst gäbe es ja wohl nicht so viele Werbeagenturen, Berater und Coaches (Coach*innen? Coachellen? Coachellas? Trainer*innen!), die sich jedes Jahr wieder in Strategieworkshops aufreiben und den neuesten, heißen Scheiß an Metaplanwände pinnen.
Ich denke, da sind wir etwas ganz Großem auf der Spur.

Schauen wir mal, was die Geschichte dazu sagt:
1) Werner von Siemens
Die Vision des Firmengründers und Namensgebers ist heute noch aktuell. Das Unternehmen hat sich inhaltlich nicht vom Gründer entfernt, sondern dessen fundamentale Prinzipien – Innovation, gesellschaftlicher Nutzen, technische Praktikabilität – weitergetragen und modernisiert. Gleichzeitig zeigt sich eine klare Erweiterung entlang der ursprünglichen Vision in Richtung moderne Technologien. Wenn man sich die Entwicklung der ersten Jahre rückblickend anschaut, erkennt man, dass es dort keinerlei Verwirrung oder modisch motivierte Tests gab.
2) Steve Jobs
Jeder Apple-Jünger weiß, dass der starke Wille des Gründers nicht nur bei seinem Rausschmiss, sondern auch bei der späteren Wiedereinstellung und schließlich am gigantischen Erfolg des Unternehmens einen sehr wichtigen Anteil hatte. Vom Weg abweichen war nicht sein Ding, egal, welche kurzfristigen Gewinne auch lockten. Er hatte eine klare Meinung zu Marktanalysen („It’s not the customer’s job to know what they want.“) und meinte damit, dass sich Innovation nicht nur an aktuellen Kundenwünschen orientieren darf, sondern visionär sein muss. Viele Projekte setzte er gegen interne und externe Widerstände durch.

Foto von Museums Victoria auf Unsplash
Aber gab es nicht haufenweise Verbesserungsvorschläge – oft auch wegen offensichtlicher Designpannen? Was ist mit dem täglichen, gequälten Aufschrei hunderttausender enttäuschter User, wenn die leere Maus mal wieder mitten im Arbeitstag leblos mit dem Stecker im Po auf dem Rücken liegt und auf Strom wartet? Hätte Steve die verdammte Buchse nicht so anordnen können, dass man zur Not weiterarbeiten könnte? Das kann doch wohl nicht so schwer sein?
Ich denke dann immer, dass er diese Hilferufe nicht gehört hat, weil er zum Geldzählen im Keller war. Bei Käufen von Zweit-Mäusen und induktiven Ladestationen kommt ganz schön was zusammen … Andererseits: Wenn man den Charakter der Person Jobs verstanden hat, scheint es wahrscheinlicher, dass er um jeden Preis verhindern wollte, dass Leute mit einer kabelgebundenen, unästhetischen Mittelalter-Maus weiterarbeiteten.
Na gut, das sind zugegebenermaßen ziemlich drastische Beispiele. Im Gründungsalltag ist es oft nicht so einfach zu entscheiden, wo der Kumpel abends in der Kneipe labert – oder ins Schwarze getroffen hat.
Praktisches Beispiel gefällig, bei dem man erkennt, wo man sich verzettelt? Gerne.
Denkt euch bitte mal in Hifi-Boxenbau hinein. Fertig? Dann los:

Foto von Vaido auf Unsplash
Die Entwicklung ist abgeschlossen, kann zwar immer noch leicht optimiert werden, aber für den Moment ist man happy. Der Einkauf hat genügend Holz, Draht, eventuell Weichen und Speaker besorgt bzw. die Versorgung für die ersten zwei Jahre gesichert. Die Montage ist geübt und eingespielt, der Vertrieb hat Händlerkontakt und meldet erste Verkäufe, und der Versand wartet schon mit dem Tesa-Roller in der Hand auf die ersten großen Pakete.
Alles prima, und im ersten Jahr schafft man mit ein bisschen Glück den halben Weg zum Break-even. Bei einem Paarpreis von 2.000 € kann man 150 Stück liefern und würde dann einen Umsatz von 300.000 € erzielen. Da muss also noch ein bisschen zwischenfinanziert werden, aber im Großen und Ganzen ein solider Plan.
Die drei Jahre Entwicklungszeit kann man als persönliches Wachstum abschreiben, und die zwei Jahre davor als Student hat man für „Jugend forscht“ geopfert. Partys brauchen halt laute Lautsprecher!
Jetzt passiert, was immer passiert: der drollige Kumpel Klaus aus dem Studium taucht auf (ganz genau: der, der sich schon auf dem Weg zur Party die Lichter ausgeschossen hat und die meisten Feste im Auto gepennt hat). Klaus ist nach dem Abschluss wieder in seinen alten Job als Sohn und Erbe zurückgekehrt und bei seinem Papa im mittelständischen Betrieb (Hidden Champion) im Marketing untergekommen. Was bedeutet, dass er jedes Jahr zum OMR fährt.
Während Klaus hauptberuflich darauf wartet, dass sich sein Paps beim Rauskugeln aus dem Testarossa Baujahr ’95 das Schlüsselbein bricht, in Rente geht und er den Laden übernehmen kann, richtet er sich schon mal ’ne coole Bude ein. Soweit man bei einer „Bude“ im Sauerland überhaupt von cool reden kann. Und dafür fragt er bei unseren Gründern an, ob die ihm nicht so richtig geile Lautsprecher bauen könnten. Halt nicht von der Stange, sondern stylish und dabei absolut partytauglich. Ist halt ein Feingeist, unser Klaus.
Jetzt beginnt der Gedankengang bei den Gründern, der gerne auch mal im Drama endet:
Bauen wir – nein, schuften wir – für 150 Boxen im Jahr, müssen vier Leute einstellen und haben am Ende erstmal weniger Kohle als im Studium? Oder bauen wir entspannt 20 Boxen für die Söhne reicher Eltern – oder direkt für reiche Eltern in der Midlife-Crisis? Alles Einzelanfertigungen, und wir lernen reiche Leute kennen. Klaus hat zum Beispiel noch einen Regisseur an der Angel, der in Hamburg in einer Fünf-Zimmer-Wohnung an der Alster wohnt. Der hat genug Kohle für so was. Er muss nur einmal im Jahr einen Film für die Förderung drehen, und die restlichen zehn Monate sitzt er zu Hause und hört Musik. Bingo!
Hastiger Businessplan auf einem Bierdeckel in „Brittas Bier-Bummsbude“:
20.000 × 20 = 400.000 €
„Britta, noch zwei Pils!“
Klingt vertraut?

Vorsicht, Falle!
(Für die passende Hintergrundmusik zu diesem Abschnitt bitte hier klicken)
Hier versteckt sich der erste gut gemeinte Hinweis für Gründer*innen: Obwohl das Produkt dasselbe ist, haben sich mit der neuen „Chance“ Vision und Geschäftsidee grundlegend geändert.
„No-Go“ sind hier nicht die unterschiedlichen Anforderungen an die Produktion wie Großserie vs. Einzelanfertigung, sondern nämlich die Ablenkung vom ursprünglichen Plan. Ressourcen sind bei Gründungen eigentlich immer Mangelware, und wenn beide Inhaber sich begeistert auf ein total interessantes Einzelstück stürzen, muss irgendetwas anderes leiden.
Bitte um Handzeichen, wer das schon mal gehört hat:
„Bringt nicht so viel, ist aber gut fürs Image!“
Nö. Verlässlich liefern, gleichbleibende Qualität zum realistischen Preis über einen längeren Zeitraum garantieren und einhalten – das macht für einen Großserienhersteller ein gutes Image.
Bei Vollmond von Künstlerhand auf die Unterseite einer 140 Kilogramm schweren Box eingelegte Blattgold-Intarsien mit den Initialen und der Schuhgröße der dritten Ehefrau des Bestellers sind für preissensitive Käufer aus der Mittelschicht genauso wichtig wie der umgefallene Sack Reis.
Es sei denn, man schmeißt das Business-Modell um und konzentriert sich nur noch auf die Einzelstücke. Dann muss man aber auch bereit sein, die Sommer mit Verkaufsgesprächen in Strandbars auf Sylt zu verbringen. Hoch die Tassen!
Falle 2: anekdotische Evidenz
Das kennt die breite Öffentlichkeit seit der Corona-Zeit. Wenn 100 Wissenschaftler eine Sache sagen und nur einer eine andere, berichtet die Presse plötzlich, dass die Wissenschaftler geteilter Meinung seien.
In der Wirtschaft passiert das jeden Tag: Die Verkaufszahlen blauer Socken stimmen mit der Marktforschung überein, aber ein Kollege auf dem Golfplatz hat das Gefühl, in dieser Woche nur rote Socken verkauft zu haben. Da steht der Unternehmer nach der Runde grübelnd an der Sektbar und fragt sich, ob sein Geschäft nicht in die Binsen geht und er vielleicht besser auf rote Socken umschwenken sollte.
Aber auch Leute, die es wissen sollten, liegen mit ihren Prognosen mal daneben. 1943 meinte der IBM-Chef Thomas Watson: „Ich denke, es gibt vielleicht einen Weltmarkt für fünf Computer.“
Das könnte man ruhig unkommentiert als letzten Satz so stehen lassen. Spätestens hier sollte klar sein, dass man jeden Rat und gut gemeinten Tipp kritisch hinterfragen sollte, bevor man hastig unnötige Kurskorrekturen vornimmt.
Aber noch besser als Steve Jobs hat der ehemalige Eishockeystar Wayne Gretzky seine Spielweise beschrieben – was man auch als Leitlinie für junge Gründer*innen verstehen kann:
„I skate to where the puck is going to be, not where it has been.“
Was also tun? Ganz klar: Der Mittelfinger in der Überschrift geht an Kneipengespräche und Golfplatzweisheiten.
Um sich zu informieren, bemüht man als Gründer bewährte Quellen – verpflichtet sich aber auch hier zum ständigen Faktencheck.
Seriöse Beratungsangebote gibt es bei Sparkassen, Gründerzentren und vielen staatlichen Stellen.
Darüber berichten wir im nächsten Heft ausführlich. Seid gespannt.