Im Februar 2022 änderte sich mit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf einen Schlag auch die Situation der deutschen Energieversorgung.
Seitdem wird viel über Strom und Wärme geschrieben, berichtet und gestritten, aber für jeden von uns im Rhein-Main-Gebiet, der abends das Licht anknipst oder es im Winter auch gerne mal etwas molliger hatte und die Heizung höher stellte, änderte sich gefühlt … NICHTS!
Das lässt uns manchmal vergessen, dass auf der anderen Seite der Leitungen Menschen hart dafür arbeiten, dass wir möglichst nichts mitkriegen von den Herausforderungen, notwendigen Umstellungen – von der Energie- und Wärmewende.
Stellvertretend für alle, die jeden Tag Probleme lösen, Modernisierungen anstoßen und den Ausbau vorantreiben, sprechen wir mit Dr. Michael Maxelon, dem Vorstandsvorsitzenden der Mainova AG in Frankfurt. Nicht nur einer der größten Energieversorger Deutschlands, sondern auch einer der beliebtesten. Nach zwei Stunden Gespräch wissen wir auch, warum.
Der Anlass, der uns heute hier zusammengebracht hat, ist das Theaterfest „Passionsspiele der Demokratie“, das im Mai in der Paulskirche stattfindet. Mainova ist als Förderer dabei.
Herr Maxelon, wie wichtig ist die Rolle von Mainova als Energieversorger in Frankfurt für die Demokratie?
Das Thema ist uns unwahrscheinlich wichtig. Ich finde, das ist etwas, was Frankfurt eigentlich auf den Leib geschneidert ist. Hier über Demokratie zu sprechen, am Ort des Grundgesetzes, im Schatten der Paulskirche, das ist doch ein Riesenpfund. Das fand ich übrigens interessant, als jemand, der zum zweiten Mal in seinem Leben nach Frankfurt gekommen ist.
Zum zweiten Mal?
Ja, zum zweiten Mal. Ich habe nach dem Studium meinen Berufseinstieg hier gemacht und dann festgestellt, dass dieser fantastische Ort, der eigentlich bürgerlich geprägt ist, immer wieder neu nach seiner Identität sucht. Und das fand ich interessant.
Was hat Sie denn wieder nach Frankfurt geführt?
Die Einladung zur Mainova. Das ist in unserer Branche eine tolle Geschichte. In meinem Verständnis zählt Mainova zu den zehn größten Energieversorgern in Deutschland. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit so einem Unternehmen noch einmal ein neues Kapitel zu schreiben.
Ich war in meiner Heimatstadt Kassel gut acht Jahre tätig. Aber irgendwann kommt ein Punkt, an dem man sich entscheiden muss: Macht man das jetzt bis zum Ende der eigenen beruflichen Laufbahn oder will man noch etwas Neues versuchen? Und das mit dem neuen Versuchen, da musste ich bei Mainova nicht lange nachdenken.
Ich halte es auch für gut, wenn die Zeiträume, in denen eine Person ein Unternehmen endverantwortlich führt, nicht endlos werden. Wenn das, was man bieten kann, drin ist, dann ist der Grenznutzen abnehmend. Dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn jemand anderes übernimmt und wieder neue Ideen einbringt. Das ist meistens gesund für das Unternehmen.
Acht Jahre sind schon eine ziemlich lange Zeit. Da sieht man auch schon die Ergebnisse von den Dingen, die man angestoßen hat.
Ja, da ist sehr viel passiert in der Zeit. Das sieht man zum Teil auch von außen in den Sachen, bei denen jeder mitreden kann. Aber das Wesentliche, was mich antreibt, ist eigentlich, was in der Organisation selbst passiert.
Was passiert mit den Menschen? Hat man es geschafft, die zu verbinden? Hat man es geschafft, dass eine Organisation sich selbst trägt, weil man Klarheit geschaffen hat über die Frage, wo die Reise hingehen soll? Wer kann welchen Beitrag leisten? Wie arbeitet man zusammen, sodass man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt, sondern tatsächlich in die gleiche Richtung geht? Das ist ein Kontrast zu dem hierarchischen Führungsstil, der in unserer Branche – und auch in anderen – immer noch verbreitet ist. Ich verfolge einen anderen Weg.
Man muss jetzt nicht den Start-ups hinterherhecheln, aber was man von denen mitnehmen kann, das ist, was die gerne „purpose-driven company“ nennen. Ich finde es einfach gut, wenn die Leute wissen: Wo wollen wir hin und warum wollen wir das? Wenn man beides geklärt hat, dann entfesseln sich die Kräfte der Organisation. Wenn alle Entscheidungen aber über nur einen Schreibtisch gehen müssen, sind alle gefesselt. Wenn man Klarheit über die Richtung hat, wo es hingehen soll, dann können alle freier mitspielen.
Die Firmen, die sich – in alter Sprechart – der Daseinsvorsorge widmen, die haben immer etwas gemeinsam in ihren Genen. Das ist dieser Wunsch, tatsächlich einen Unterschied zu machen. Etwas zu tun, was sinnvoll ist. Und das ist jetzt noch mal sinnvoller geworden, durch die Erkenntnis, dass unsere sichere Versorgung ein Fundament für gesellschaftliches Leben und wirtschaftliche Prosperität ist und wir ein wichtiger Akteur für den Klimaschutz sind.
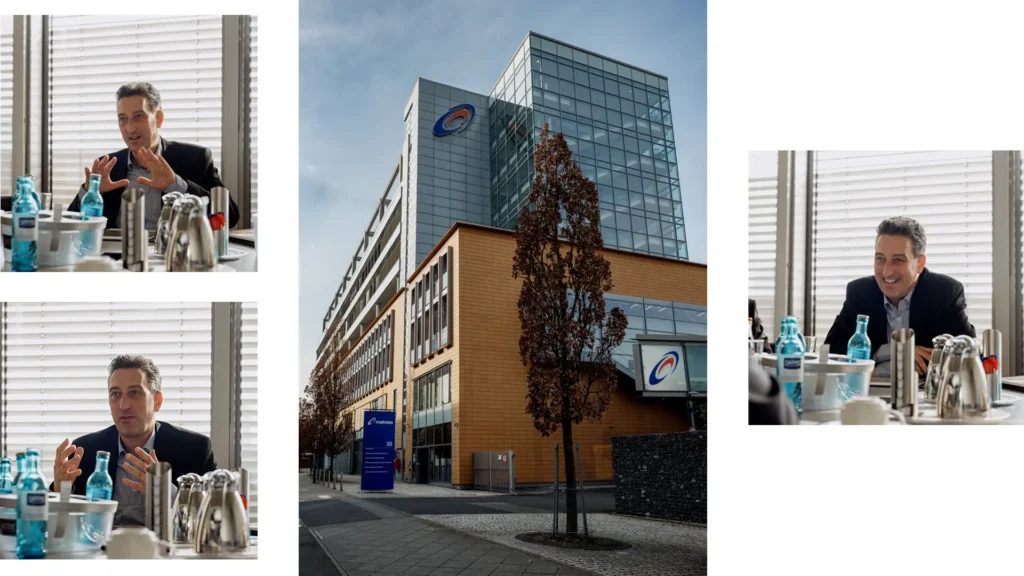
Wir haben es bei der Ankunft schon gemerkt: Das Parkhaus ist umgebaut, E-Autos an jeder Ecke. Wahrscheinlich begeistert Sie die Wende in der Energiepolitik, oder?
Es passiert momentan in der Energieversorgung ein sehr gravierender Wandel, den ich sehr spannend finde.
Die Energieversorgung, die zuvor eigentlich eine sehr traditionelle Branche war, hätte mich wahrscheinlich nicht so sehr begeistert, wie sie es aktuell tut. Mit der Liberalisierung, die 1998 begonnen hat, ging es in dieser Branche immer weiter in einen Wandel hinein. Und Wandel umfasst natürlich das ganze Thema der Energie- und Wärmewende, aber auch die Digitalisierung und intelligente Steuerung von Erzeugung und Verbrauch. Diese Transformation finde ich großartig, weil man aufgefordert ist, zu inspirieren, zu gestalten. Und man kann tatsächlich auch Neues wagen.
Merken Sie, dass die Leute auf zwei Seiten stehen, was Veränderungen in die nachhaltige Richtung angeht?
Die Energieversorgung selbst hat sich jahrzehntelang immer mit ihrem Zieldreieck Orientierung gegeben, das steht ja sogar im Energiewirtschaftsgesetz. Dieses energiewirtschaftliche Zieldreieck besteht aus dem Klimaschutz, der Versorgungssicherheit und der Bezahlbarkeit. Und stabil steht so ein Dreibein eben, wenn diese drei Säulen möglichst gleichmäßig tragend sind. Wir hatten jetzt eine Phase, in der das Thema Klimaschutz sehr viel stärker betont wurde, aber das nivelliert sich jetzt wieder aus.
Ich glaube, niemand wird in dieser Branche sagen: „Den Klimaschutz stellen wir hinten an.“ Wir müssen uns jedoch zum Beispiel bei der Bezahlbarkeit die Frage stellen, wo das Geld dafür herkommt. Die dritte Säule darf man aber auch nicht vergessen. Die Versorgungssicherheit ist von höchster Bedeutung. Der Roman „Blackout“ von Marc Elsberg ist ja mittlerweile ein Klassiker. Da steht unterhaltsam beschrieben, was passiert, wenn der Strom über längere Zeit weg wäre. Und das darf uns nicht passieren.
Die beiden anderen Punkte, also die CO2-Reduktion in den Griff zu bekommen und gleichzeitig bezahlbar zu bleiben, das wird für uns durchaus eine Herausforderung sein. Insbesondere, weil viele Entscheidungen eingeloggt sind, deren finanzielle Antwort jetzt erst auf uns zukommt.
Ich habe manchmal den Eindruck, wir stehen in Deutschland wie vor einem Baum voller reifer, roter Äpfel.
Jeder Apfel steht dabei für eingespartes CO2. Wir könnten die Hand ausstrecken, die greifbaren Äpfel nehmen und sagen: „Mensch, klasse, hier haben wir schon mal CO2gespart.“ Aber wir stehen davor und denken zunächst über ein Konzept nach, mit dem wir auch die letzten Äpfel ganz oben in der Baumkrone ernten können. Ich hoffe, dass wir wieder pragmatischer werden und erstmal die Äpfel nehmen, an die wir herankommen. Dann kommt der Bruder mit seiner Leiter aus der Garage und wir ernten noch mehr Äpfel. Und um die drei in der Spitze kümmern wir uns, wenn wir den Rest im Sack haben.
Das ist ein gutes Bild. Wie kriegen wir das hin?
Ich glaube, wenn wir wieder in einen normalen Prozess des Ringens nach den besten Lösungen kommen, dann ist das ein guter Schritt. Ein Thema ist der „deutsche Sonderweg“, es mit volatilen Erzeugern zu versuchen, also mit Strom aus Wind und Sonne. Mein Eindruck ist, dass gegenwärtig die ganze Welt schaut, was die Deutschen da so machen mit ihren Erneuerbaren Energien, Photovoltaik und Wind.
Wir haben eigentlich alles, was es braucht: Wir haben sehr kluge Köpfe, wir haben den Willen, es hinzukriegen, wir haben die Ressourcen, es zu schaffen. Und wenn wir es in zehn Jahren hingekriegt haben, dann kopieren es alle anderen Länder. Umgekehrt gilt das aber auch. Wenn wir es in zehn Jahren nicht hingekriegt haben, dann sagt die Welt „Das Thema kannst du abschreiben, das wird nie was.“
Ich glaube, wir haben aber allen Grund zum Optimismus, dass uns das gelingen wird.
Haben wir zu viel Bürokratie, die solche optimistischen Pläne erschwert?
Die Frage der Genehmigungsverfahren ist schon eine, die uns umtreiben sollte. Unser Interesse als Energieversorger ist, dass wir beim Genehmigungsverfahren auch den Ausgleich der Interessen haben, und dass es da eine rechtliche Sicherheit gibt. Es ist uns nicht geholfen, wenn wir einen Windpark bauen und nachher wird der Genehmigungsprozess infrage gestellt. Es muss schon rechtssicher sein, denn eine Windkraftanlage aufbauen und wieder abbauen, davon hat keiner etwas. Das Unternehmen nicht, aber das Klima erst recht nicht. Von daher ist dieser Ausgleich der Interessen in einem Genehmigungsverfahren schon gut. Die Frage ist, ob man das beschleunigen kann. Oder, wenn die Qualität nicht leidet, gerne auch vereinfachen. Das wäre schon hilfreich.
Wie sieht denn die Energiesituation im Rhein-Main-Gebiet in den nächsten zehn Jahren aus, wenn die Genehmigungsprozesse mitspielen?
Es empfiehlt sich eigentlich nicht, das Rhein-Main-Gebiet in der Energieversorgung isoliert zu betrachten, weil wir zum einen in den deutschen Regelungsrahmen und zum anderen in einen Energieweltmarkt eingebettet sind. Und in diesem Rahmen müssen wir uns bewegen. Von daher denke ich, dass wir vor allem eins leisten werden, und das ist der bedarfsgerechte Ausbau der Infrastruktur. Insbesondere der Stromnetzausbau, der sehr umfassend ist.
Warum ist das so?
Weil mit der steigenden Elektrifizierung die durchschnittliche Kapazität eines Hausanschlusses steigt.
Das kommt sowohl durch die Mobilität, vor allem die Elektromobilität, aber auch durch Wärme, über die Wärmepumpen und die Eigenerzeugung durch Photovoltaik auf dem Dach. Und die Kapazität der Zuleitung in der Straße muss dementsprechend verstärkt werden.
Man muss also alles erneuern, damit diese Menge, die da fließen soll, auch fließen kann?
Genau. Allein in den nächsten Jahren wird es in Frankfurt einen deutlichen Ausbau der Stromnetzkapazität geben. 1000 Megawatt haben wir derzeit an Anschlussleistungen, und die Weichen sind gestellt für eine Verdopplung dieser Leistung. Zum Vergleich: Eine Stadt wie Hannover hat 500 Megawatt Anschlussleistung.
Auch im europäischen Vergleich ist Frankfurt da herausragend, und das kommt daher, dass Frankfurt eine wachsende Stadt ist. Mehr Bevölkerung braucht auch mehr Energie. Die beiden eben genannten Effekte, sowohl die Integration des Mobilitätssektors in den Strombereich als auch ein Teil des Wärmesektors in den Strombereich, tragen dazu bei. Und in Frankfurt gibt es dann auch noch das Sonderthema der Rechenzentren.
Wo liegen die und wie viele sind das?
Nach meiner Kenntnis haben wir allein in Frankfurt etwa 70 Rechenzentren in Betrieb und eine Vielzahl weiterer befinden sich gegenwärtig in der Genehmigung. Da wird die Frage sein, wie es mit dem Bedarf dieser wichtigen digitalen In-frastruktur weitergeht.
Zurück zu unserer Heimat. Wie geht es energiepolitisch oder energiewirtschaftlich für das Rhein-Main-Gebiet weiter?
Das eine ist der Ausbau der Stromverteilkapazitäten in der Region. Das zweite sind die eben schon zitierten Übertragungsnetze, die in die Region geführt werden müssen, damit die grünen Elektronen dann auch hier ankommen.
Und drittens: der Ausbau des Energiesystems, sowohl mit den erneuerbaren Einspeisern wie auch den sicheren verfügbaren Kapazitäten für die berühmte Dunkelflaute. Also für den Fall, dass weder Sonne noch Wind da sind und es demzufolge zu wenig Strom im System gibt. Auch das muss gelöst werden.
Im Einklang mit dem europäischen Green Deal setzt man dabei auch auf Wasserstoff. Von daher ist es wichtig und gut, dass wir mit „Rh2ein-Main Connect“ ein klares Konzept für ein Verteilnetz haben, Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet an das Kernnetz für Wasserstoff anzuschließen. Wir bleiben eine energieimportierende Nation, und wenn wir das mit grünen Molekülen decken wollen, dann ist es naheliegend, über Wasserstoff nachzudenken. Also muss es eine internationale Wasserstoffwirtschaft geben. Da ist auch Tempo gefragt, denn die Entscheidungsträger bei unseren Kunden fragen natürlich nicht nur, wann der Wasserstoff denn kommt, sondern auch, welche Mengen wir haben und zu welchem Preis. Momentan können wir das nicht beantworten.

Wir haben vor einigen Wochen ein Gespräch mit einem Start-up geführt, das Autos mit Wasserstoffverbrennungsmotoren ausstattet, um sie effizienter und nachhaltiger zu machen. Was halten Sie von solchen Ideen?
Es gibt gerade in Frankfurt eine sehr rege Szene, die sich darum bemüht, gute Bedingungen für Start-ups zu schaffen, und das auch durchaus erfolgreich. Ich glaube, dass wir da schon gute Rahmenbedingungen haben. Allein, wenn ich in unser Haus hineinschaue. Aber die Begeisterung, neue Wege zu beschreiten, ist auch außerhalb von Mainova schon sehr groß, Ich glaube, da können wir durchaus optimistisch sein.
In welchen Punkten sehen Sie noch Potenzial?
Früher haben wir in der Energieversorgung die Erzeugung dem Verbrauch nachgefahren. Jetzt ist es so, dass die Erzeugung sehr volatil ist, sie geht rauf und runter. Und da gibt es wiederum Grund zum Optimismus, weil wir für dieses Vernetzen von Erzeugung und Absatz die nötigen Fähigkeiten haben.
Auch bei den Technologien lernen wir dazu. Plötzlich sind Batteriespeicher in einer kommerziellen Phase angekommen, wo schon jeder Häuslebauer darüber nachdenkt, eine Photovoltaikanlage anzuschaffen. Wir haben es alle erkannt: Wenn die Strompreise rauf und runter gehen, dann kann ich einen Speicher wirtschaftlich betreiben. Und wenn ich das kann, dann baue ich Infrastruktur zu.
Und dass das wirkt, das haben wir alle gemeinsam erfahren dürfen, als dieser schreckliche Invasionskrieg in der Ukraine losbrach und uns plötzlich die russische Gasversorgung wegbrach. Da haben wir gigantische Gaspreise gesehen, aber ein Jahr später war von diesem Peak nichts mehr zu sehen. Und warum? Weil wir Infrastruktur zugebaut haben. Wir haben diese enorme Anpassungsgeschwindigkeit, und deshalb wird es uns auch gelingen, wenn es darum geht, die Volatilitäten am Markt auszugleichen.
Und wie sieht es in Frankfurt mit der Wärmeversorgung aus?
Wir werden die Fernwärmeversorgung in Frankfurt dekarbonisieren. Der erste Schritt dafür ist unser größtes Heizkraftkraftwerk, da wurde bisher Kohle verbrannt und ab 2026 wird das ersetzt durch ein wasserstofffähiges Gaskraftwerk. Das spart 400.000 Tonnen CO2 im Jahr ein – da werden dann mal die niedrig hängenden Früchte geerntet. Das neue Vorbildkraftwerk ist in der Lage, im Sinne des EU Green Deals durch Fuel Switch auf Wasserstoff umgestellt zu werden.
Wir nutzen auch alle weiteren klimafreundlichen Erzeugungs-Möglichkeiten, um die Wärmeversorgung zu vergrünen. Wir hatten die kreislaufwirtschaftlichen Aspekte heute schon, dabei sind die Müllverbrennungsanlagen ein wichtiger Teil. Müll muss thermisch verwertet werden. Wenn er also verbrannt wird, dann macht es auch Sinn, die Wärme zu nutzen.
In unserer Energieversorgung sind die Systeme Kraft-Wärme-gekoppelt. Es wird Wärme ausgekoppelt und zeitgleich Strom erzeugt. Der Strom wird verkauft und dämpft den Fernwärmepreis. Das ist alles ein hoch integriertes System, bei dem nicht immer alles neu ist. Was aber neu ist: Wir erschließen neue Fernwärmequellen, zum Beispiel über Großwärmepumpen. In unserem Gemeinschaftskraftwerk in Hanau wird so eine auch eingesetzt. Dort kommt außerdem noch ein Rechenzentrum als Wärmequelle hinzu – dessen Abwärme ist auch 30 Grad warm. Mit unserem ersten eigenen Rechenzentrum erfreuen wir die Besucher der Batschkapp an der wohltemperierten Atmosphäre. Auch eine Tiefengeothermie wird für Frankfurt erkundet. Wir stellen uns jedenfalls so breit auf, dass wir nicht vom Wasserstoff abhängig sind.
Auch außerhalb von Frankfurt haben wir ein sehr großes Versorgungsgebiet, in dem wir vor allem Gasversorger sind. Da braucht es natürlich auch Lösungen, über die wir uns Gedanken machen, und auch da muss man das Zieldreieck im Hinterkopf behalten. Versorgungssicherheit, aber vor allem Bezahlbarkeit und ökologische Aspekte müssen im Gleichgewicht bleiben. Und auch da gilt wieder der Optimismus.
„Das Zieldreieck
Versorgungssicherheit,
Bezahlbarkeit
und ökologische
Aspekte muss
im Gleichgewicht
bleiben.“
Die Branche und wir sind uns absolut einig: Wärmepumpen werden in Zukunft immer leistungsfähiger und immer günstiger werden. Das ist erstmal ein guter Ausblick für die Zukunft, wenn die Dinge besser und preiswerter werden. Ich bin mir sicher, wir haben heute noch nicht alle Lösungen, wie man Wärme künftig erzeugen kann, im Blick.
Also wenn wir 25, 30 Jahre nach vorne denken, dann möchte ich auch mal 25 bis 30 Jahre nach hinten denken. Womit waren wir denn vor 30 Jahren im Internet? Und jetzt fassen Sie nicht zu Ihrem Smartphone, denn das gab es noch nicht. Es gibt heute Dinge, die gehören zum täglichen Leben dazu, die wir vor 30 Jahren noch nicht kannten. Damals hatten die Telefone noch Tasten. Außer man hat Star Trek geguckt. Scotty hatte sowas wie Smartphones damals schon, und heute haben wir sie alle in der Hand. Damals dachten wir, wie soll das jemals funktionieren?
Stimmt, da hat sich ganz schön was entwickelt.
Es gibt einfach Dinge, die wir heute tatsächlich noch nicht im Einsatz haben, die wir aber meines Erachtens in 20 Jahren haben können. Wenn ich sowas sage, werde ich meistens gefragt: „Woran denken Sie denn?“ – was eine gemeine Frage ist. Ich rede von etwas, was ich noch nicht kenne.
Aber ein Beispiel: Wir können Methan, also Erdgas, durch eine Plasmalyse oder Pyrolyse, auf jeden Fall mit hohen Temperaturen, in seine eigenen Grundstoffe zerlegen. Wenn wir das zerlegt haben, kommt am Ende einer Methan-Plasmalyse tatsächlich Wasserstoff raus und es entsteht kristalliner Kohlenstoff. Das ist ein begehrter Grundstoff, den viele, zum Beispiel Reifenhersteller, heute noch aus Erdöl machen. Und das wollen wir auch nicht mehr haben.
Dieses Vorgehen ist heute ein Demonstrator der Stufe Neun. Demonstratoren sind die Stufen, die ein Prozess durchläuft, bevor er in eine großtechnische Umsetzung geht. Neun ist die höchste Stufe. Es ist also nicht alles nur Fantasie. Sie schalten dann dieses Gerät vor Ihre Gastherme, stellen die auf Wasserstoff um und sind fertig mit der Energiewende. Wäre vielleicht nicht sinnvoll, den Kohlenstoff dann jedes Mal eigenhändig aus dem Heizungskeller kratzen zu müssen, aber man kann das ja auch an zentralen Punkten im Netz tun.
Ist das die Zukunft, die ich Ihnen jetzt voraussage? Ich weiß es auch nicht, ich habe keine Glaskugel. Ich will nur ein Beispiel geben, dass Dinge heute schon in einem Zustand sind, der durchaus Hoffnung gibt.
Die Zusammenarbeit mit Start-ups bei sowas ist nicht brandneu, aber das Verständnis, dass es gut zusammenpasst, das setzt sich durch. Wir haben gelernt, dass wir kein Start-up sind, aber wir können Elemente aus Start-ups nutzen.
Aus Start-ups wird ja aber vielleicht der Nachwuchs für Mainova herkommen.
Ich war schon immer sehr stolz darauf, dass es gelungen ist, in die Unternehmen, die mir anvertraut waren, gute Leute zu holen.
Ich kann aber auch sagen, dass es hier in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet viele Leute gibt, die hierherkommen, um ihre Karriere zu starten. Ich war damals auch einer davon.
Mainova ist ein tolles Unternehmen, aber wir sind auch umgeben von anderen tollen Unternehmen. Und damit ist das durchschnittliche Grundniveau einfach mal höher. Und da halten wir als attraktiver Arbeitgeber sehr gut mit.

Die Atmosphäre ist hier also so, dass man sich sicher sein kann, eine ganze Menge Leute zu finden, die dasselbe Lebensideal haben?
Ich glaube, da würde man bei Mainova schon offene Türen einrennen. Auch die Zusammenarbeit mit Start-ups ist durchaus etabliert.
Wir sind auch Teil des Thüga-Verbundes, wo es einen Innovationsbereich gibt, der sowas durchaus tut. Da sind spannende Elemente dabei. Wir nutzen auch künstliche Intelligenz an verschiedensten Stellen. An Stellen, wo Sie es vielleicht gar nicht erwartet hätten, zum Beispiel beim Kraftwerkseinsatz. Kraftwerkseinsatzoptimierung ist ein Riesenfeld, in dem Kollegen schon seit langem von KI wirkungsvoll unterstützt werden.
Und dass Mainova in der Lage ist, das eigene Kerngeschäft sinnvoll zu ergänzen, können Sie auch daran festmachen, dass wir in das Rechenzentrumsgeschäft eingetreten sind.
Rechenzentren sind digitale Infrastruktur und mittlerweile auch als kritische Infrastruktur anerkannt. Sie haben damit eine gewisse Gemeinsamkeit mit der Energieinfrastruktur: Wenn Rechenzentren wegfallen, würden wir das alle sehr schnell, sehr deutlich merken.
Gleichzeitig ist es ein Geschäft mit eigenen Regeln.
Und auf diesen Weg – mit einer zunächst einmal völlig unbekannten Kundenstruktur – hat Mainova sich begeben und ist damit so erfolgreich, dass sie dafür einen Partner in der Firma BlackRock gefunden hat. Mainova kann mühelos ein solches Geschäft machen mit einem internationalen Partner auf höchstem Niveau. Mit denen können wir auf Augenhöhe agieren und Werte schaffen, das finde ich schon bemerkenswert.
Bei solch großen Themen haben wir zum einen die Frage nach der Finanzierung und zum anderen die Frage der Fachkräfte. Deswegen hat Mainova die Ausbildung wieder in die eigene Hand genommen und ein Ausbildungszentrum gegründet, für das wir letztes Jahr sogar den „Best Place to learn“-Award gewonnen haben.
Wir arbeiten zudem eng mit Lieferanten zusammen, damit wir uns unsere Materialien sichern, und wir versuchen, Partnerschaften mit unseren Dienstleistern auszubauen. Zum Beispiel hat Mainova einen Tiefbau-Gipfel gemacht. Wir wollen damit auch überregional Unternehmen für den Stromnetzausbau und den Fernwärmeausbau gewinnen. Wollen zeigen, dass hier über Jahre hinweg auf einem hohen Niveau investiert wird und dass es sich lohnt, in Frankfurt Geschäfte mit Mainova zu machen.
Und unser wirtschaftliches Ambitionsniveau, also das, was von uns erwartet wird, steigt. Aber das Entscheidende ist, damit sich der Case rechnet, muss irgendjemand diese Investitionen auch bezahlen. Und da sind wir wieder bei dem energiewirtschaftlichen Zieldreieck.
Wir betrachten jetzt mal den Klimaschutz und das Thema Bezahlbarkeit. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie diese Aufgabe und das Thema Generationengerechtigkeit und Verteilung der Lasten erledigt werden kann. Es zahlt entweder der Kunde oder es muss durch die öffentliche Hand finanziert werden, was aber auch nichts anderes heißt, als dass es die Bevölkerung durch das Steueraufkommen zahlt. Deswegen muss man abwägen, wie die Umsetzung möglichst kosteneffizient gelingt, wenn wir gleichzeitig die Energiekosten senken wollen. Die Notwendigkeit, mit frischem Kapital ein vollständig neues Energiesystem zu schaffen, besteht vielleicht nicht in dem Maße, wie wir oft denken.
Und jetzt kommt die gute Nachricht – und da bleiben wir wieder bei dem Baum: Lassen Sie uns die tief hängenden Früchte ernten und uns für die Sachen in der Spitze noch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Je mehr Zeit wir für den Umbau haben, desto mehr können wir aus den bestehenden Abschreibungen finanzieren.
„Es ist absolut
sinnvoll,
bestehende
Infrastruktur
weiter zu nutzen.“
Bevor jemand seine zwar alte, aber funktionierende Gasheizung in den Ruhestand schickt und sich eine funkelnagelneue, riesengroße Wärmepumpe hinstellt, wäre es sinnvoller, sich eine kleinere Wärmepumpe neben seine Gasheizung zu stellen und beides zu nutzen. Nicht in ferner Zukunft, sondern um so heute schon wirksam CO2 einsparen.
Nutze deine vorhandenen Ressourcen, nutze deine Gasheizung an den wenigen ganz kalten Tagen, an denen die kleine Wärmepumpe nicht ausreicht. Aber den Rest des Jahres, in der Übergangsjahreszeit, zum Duschen, nutze die Wärmepumpe. Sie ist von der Investition her bezahlbar, sie ist in der Regel an die heutigen Netzkapazitäten anschließbar, man muss nicht warten, bis die Übertragungsnetze ausgebaut worden sind. Man kann die Gastherme weiter nutzen – und damit auch die vorhandene, volkswirtschaftlich schon bezahlte Kapazität für das Gasnetz – und hat damit schon einen großen Schritt geschafft. Die niedrig hängenden Früchte sind geerntet und wir gewinnen Zeit.
Die Idee müsste man ja mal in die Bevölkerung bringen, das hört sich ja ganz einfach an.
Ja, Sie können in die Niederlande schauen und feststellen, dass diese Idee woanders funktioniert. Mainova baut ja keine Luftschlösser, wir verkaufen Leuten keine Visionen.
Wir sind zwar auch mit Visionen unterwegs, aber wir verkaufen nichts, wovon man nur träumen kann. Es ist real existent und es kennt eigentlich nur Gewinner.
Was brauchen wir von der Politik, um das umzusetzen?
Die Politik setzt oft Ziele und will dann auch festlegen, wie wir sie erreichen. Wir sollten den Weg dahin aber den Fachleuten – den Unternehmen, dem Markt, der Wissenschaft – überlassen. Anstatt detaillierter ordnungspolitischer Maßnahmen sollten die Menschen, die sich damit auskennen, entscheiden, welches Instrument sie haben wollen. Am besten zusammen, um die richtige Lösung zu finden. Und da müssen wir in der Energieversorgung auch wieder hinkommen. Wir müssen uns ambitionierte Ziele setzen, aber den Weg dahin bitte frei wählbar lassen. Sonst haben so innovative Ideen wie die Methanplasmalyse und andere Dinge, die wir heute besprochen haben, keine Chance.
Wie informieren Sie sich privat über das, was so in Frankfurt und der Welt passiert?
Ich finde es inspirierend, wenn man in neue Themen reingehen kann und ich denke gerne im Diskurs. Soll heißen: Ich suche eigentlich vor allem den Austausch mit Menschen. Ich bin weniger der Aktenfresser, sondern nutze eher den Dialog und höre verschiedenen Leuten zu. Das findet mal ganz formal statt, in einem Verband wie dem BDEW (Verband der Bundesdeutschen Energie- und Wasserwirtschaft) oder dem Thüga-Netzwerk, in dem wir viel diskutieren, oder der Austausch findet im Unternehmen statt. Es geht um den Dialog, egal ob als Referent oder als Teilnehmer einer Veranstaltung.
Dieser Austausch geht aber auch im privaten Bereich. Und wenn man draußen unterwegs ist, ist man als Vertreter eines Energieversorgers eigentlich auch sehr schnell Ansprechperson für Fragen oder auch mal für Beschwerden.
Also kriegen Sie das morgens beim Bäcker schon mit, dass die Leute wissen, wer Sie sind?
Also hier in Frankfurt weniger, das ist das Privileg der Großstadt. In Kassel war das durchaus noch so. Aber das hat auch schöne Aspekte. Wenn der Straßenbahnfahrer auf die Klingel drückt, weil er einen am Straßenrand entdeckt hat, dann kann man freundlich winken.
Wir arbeiten daran, dass das hier in Frankfurt auch bald passiert. Danke für das Gespräch!
Mainova versorgt über eine Million Menschen zuverlässig mit Strom, Gas, Wärme und Wasser. Ob bei großen Bauprojekten, der Weiterentwicklung von Städten oder mit smarten Lösungen für Zuhause. Und das umweltschonend und effizient: in modernen Heizkraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung, in leistungsstarken Gaskraftwerken, über dezentrale Versorgungsanlagen sowie mit Windkraft- und Solaranlagen in ganz Deutschland.
Mehr Informationen über das Unternehmen, Services, Lösungen und Karrieremöglichkeiten findet ihr auf der Website: www.mainova.de




