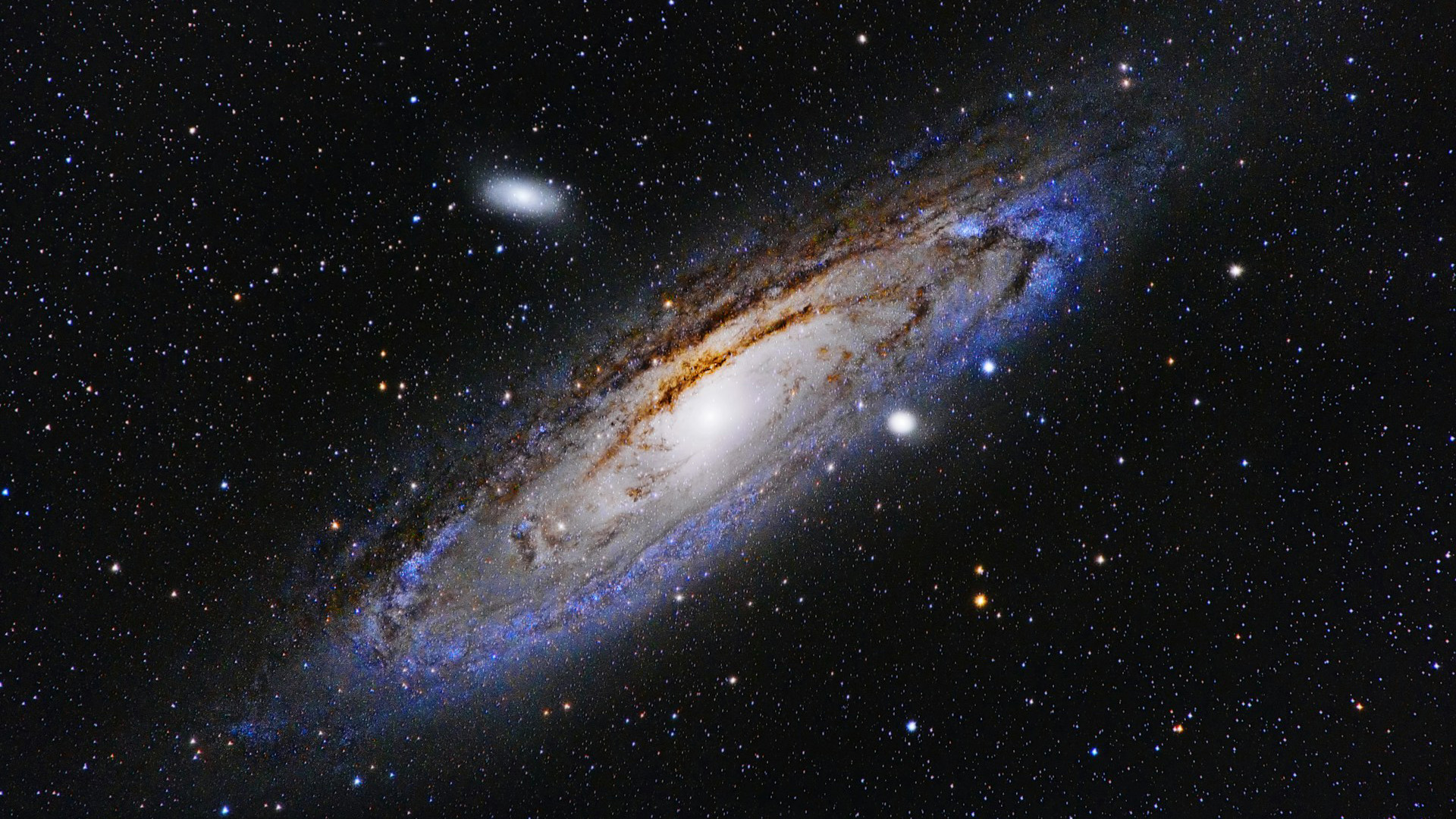40 Jahre nach dem Abi:
Die damals brandneue Schule
sieht inzwischen ein
bisschen abgerockt aus.
Macht nichts, der
ehemalige Abiturient auch.
In den Gängen riecht es immer
noch nach Angst,
Sport-Leistungskurs und
– wahrscheinlich Einbildung –
der Pfeife des ersten Direktors.
Der wartet aber nicht wie
damals an der Eingangstür
auf Zuspätkommende.
Schade, wir waren
zum ersten Mal pünktlich.
Frank
10 Jahre nach dem Abi:
Die Schule sieht fast genauso
aus wie damals.
Vielleicht ein bisschen
erwachsener. Die
ehemalige Abiturientin auch.
In den Gängen riecht es immer
noch nach Angst,
Sport-Leistungskurs und
– wahrscheinlich Einbildung –
der Pfeife des ersten Direktors.
Der wartet aber nicht wie
damals an der Eingangstür
auf Zuspätkommende.
Schade, der Chef war
zum ersten Mal pünktlich.
Chrissy
It was the best of times,
it was the worst of times, …
Lieber Peter Küsters, du hast uns beide – im Abstand von 30 Jahren – zum Abi begleitet, insgesamt also die letzten 40 Jahre als Lehrer hier miterlebt und mitgestaltet. Was hat junge Leute früher interessiert, im Vergleich zu heute? Wir möchten aus erster Hand hören, wie deine Erfahrungen sind. Deswegen sind wir wieder hier in der Claus-von-Stauffenberg-Schule in Rodgau. Erzähl uns gern mal, wo du herkommst, was du studiert hast, wie du hier gelandet bist.
Ich bin 1979 regulär in den Schuldienst gekommen, bin inzwischen schon ein bisschen überreif als Lehrkraft und mache nur noch ein paar Stunden als Ergänzungsspieler, der von der Bank kommt, wenn jemand ausfällt. Aber ich erzähle euch mal von meinem Werdegang.
Studiert habe ich Geografie und Politik in Frankfurt, mit dem Ziel, Lehrer der Sekundarstufe 2 zu werden. Damals gab es oft Schwierigkeiten, verbeamtet zu werden, da hatte man echt Anlaufschwierigkeiten, in den Beruf reinzukommen. Also habe ich am Anfang das Angebot eines Gymnasiums im Odenwald genutzt, dort anzufangen, aber parallel versucht, wieder hier in die Gegend zurückzukommen, weil mein soziales Umfeld aus dieser Gegend kommt. Die Claus-von-Stauffenberg-Schule war also meine zweite Station, und ich war dann auch relativ schnell sehr begeistert davon, hier an der Oberstufe gelandet zu sein. Das Fach Geografie war nicht mehr stark vertreten, aber Politik – das hieß ja damals noch Gemeinschaftskunde –, das gab es. Das Fach war ein bisschen anders als PoWi heute, weil Gemeinschaftskunde auch Geschichtsanteile hatte. Das ist später klarer getrennt worden und wir konnten uns dann speziell auf politische Entwicklungen konzentrieren, was ich auch persönlich gut finde.
Wie kam es zur Entscheidung, Geografie und Politik zu studieren? Hattest du schon immer Interesse an diesen Bereichen?
Ich wollte ursprünglich mal Kunst studieren, davon haben mich aber verschiedene Aspekte abgebracht. Ich war mir aber sicher: Lehrer will ich auf jeden Fall werden. In meiner eigenen Schulzeit waren Politik und Geografie die Fächer, die für mich im Mittelpunkt gestanden haben.

Wie beeinflussen diese Themen dein Leben – beruflich und darüber hinaus?
Ich unterrichte diese Fächer so gerne, weil das auch mein privates Interesse ist. Primär Politik, aber darüber hinaus auch Kunstgeschichte. Ich gehe gerne in Museen, besuche Ausstellungen, tausche mich auch gerne mit den Kolleginnen und Kollegen aus, die Kunst unterrichten.
Wie empfindest du persönlich die politische Lage in Deutschland?
Sehr ambivalent. In meinem Bekanntenkreis – gerade auch in der Runde mit ehemaligen Kollegen und Kolleginnen, die wir regelmäßig abhalten – wird viel darüber diskutiert. Ich bin in diesen Fragen eher optimistisch. Immer nur alles schlechtreden und sagen, es geht alles bergab, davon bin ich kein Fan. Wir haben zwar sehr starke rechtspopulistische bis faschistoide Entwicklungen in Deutschland, man muss es allerdings zahlenmäßig ein bisschen runterbrechen. Wenn wir die letzten Wahlen anschauen, gab es knapp 20 %, die gar nicht erst wählen gegangen sind. Wenn man die mit einberechnet, reduziert sich der Anteil, der auf die AfD gefallen ist, noch mal ein ganzes Stück. Die Frage ist natürlich, ob sich das weiter ins Negative entwickeln wird oder ob das jetzt ein Höhepunkt ist. Das ist eine unheimlich schwierige Frage, weil das von so vielen weltpolitischen Ereignissen und wirtschaftspolitischen Entwicklungen abhängig ist.
Wenn wir uns die USA anschauen: Ich habe gerade heute Morgen in einem Artikel gelesen, dass der größte Anteil von Trump-Wählern aus dem abgehängten, weißen und vor allem männlichen Mittelstand kommt. Dieses Gefühl, abgehängt oder vergessen zu werden, ist eine reale Entwicklung, die plötzlich ganze Bevölkerungsgruppen betrifft, die sich wirtschaftlich deklassiert sehen und ihre Wertvorstellungen hinterfragen. Also eine Gruppe, die gerne Zeiten reaktivieren möchte, die wirtschaftlich gesehen wesentlich günstiger für sie waren.
Der Anteil in den USA, die Trump tatsächlich gewählt haben, ist, auf die gesamte Bevölkerung bezogen, relativ gering. Das ändert natürlich nichts an dem Wahlerfolg, weil das System halt so ist, wie es ist, und die gesellschaftlichen Strukturen eine hohe Zahl an Nichtwählern hervorbringen. Aber auch da könnte man sagen: Die Trump-Wähler sind eigentlich in der Minderheit. Und das kann man positiv sehen. Auch wenn Trump jetzt alles versucht, um rechtsstaatliche Standards abzubauen, um vielleicht auch längerfristig Macht zu sichern: Der größere Teil der Bevölkerung ist dagegen oder zumindest von dieser Entwicklung nicht begeistert, und das ist gut.
Stellst du diese politischen Differenzen auch bei den Schüler:innen fest?
Nein. Vielleicht könnte der eine oder die andere dabei sein, die politisch etwas anders sozialisiert ist und daher auch einen gewissen Widerspruch in sich trägt, aber den nicht nach außen bringt. Ich vermute aber, dass die große Mehrheit unserer Schülerschaft auch vor dem Hintergrund ihrer Schichtzugehörigkeit nicht anfällig für irgendwelche AfD-Thesen ist. Einzelne gibt es sicher, aber im Schulalltag schlägt sich das bei uns nicht nieder.
Wir leben hier in einer Blase, das muss man natürlich auch sagen. Das ist auch ein Thema, was mich persönlich auch immer umtreibt. Ich denke, man muss immer wieder hinterfragen, inwieweit man sich auch in seinen eigenen Denkstrukturen in solchen Blasen bewegt. In Gesprächen, gerade im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis, da weiß man, wie die anderen ticken, und man weiß, dass die Ansichten nicht so extrem von der eigenen Position abweichen. Es kreist alles so um sich selbst. Das sehe ich ein bisschen als Gefahr.
Das geht bis in die politische Ebene rein. Wenn man guckt, wie viel Prozent der Abgeordneten der letzten Bundestagswahl nicht akademisch ausgebildet sind, dann ist das eine unheimlich geringe Prozentzahl. Das ist ein Punkt, wo die AfD mit Erfolg reingrätscht und sagt, sie würden die Interessen des einfachen Volkes vertreten. Aber es ist leider auch ein Funken Wahrheit dabei. Unsere politische Vertretung, gerade auf der höheren Ebene, ist wirklich sehr stark durch eine ganz bestimmte Bevölkerungsschicht geprägt – die akademische. Das wird auch ein bisschen als Problem wahrgenommen. In der Alltagssprache äußert sich das in so Aussagen wie: „Die machen eh, was sie wollen“ und „Wir werden abgezockt“ und so weiter. Das ist der Ausdruck einer bestimmten Entwicklung, die in Teilbereichen problematisch ist: Bestimmte soziale Entwicklungen laufen tatsächlich zu Ungunsten einer größeren Bevölkerungsgruppe. Vor allen Dingen bei der Frage von Einkommen und Vermögen sieht man, dass die Schere immer weiter auseinander geht. Und da ist es klar, dass dieser Unmut, der sich natürlich vollkommen undifferenziert äußert und aus den Leuten rausbricht, auch einen Funken Wahrheit enthält. Es ist eine Entwicklung, die problematisch ist.
Mit der Schere, die auseinander geht, sieht man ja auch, wie sich das politisch trennt. Wir haben rechts einen Zuwachs, aber auch genauso links. Es wird also radikaler an beiden Enden?
Naja, die Entwicklung nach links ist aus meiner Sicht nicht ganz so problematisch, weil sie sich im Rahmen des Grundgesetzes bewegt und gewisse Aspekte von Ausgrenzung und Diskriminierung nicht beinhaltet. Es gibt sicher Themen von der Linken, die ich nicht unbedingt unterschreiben würde, aber ich würde das anders bewerten. Es gibt eine Entwicklung nach rechts und nach links, aber inhaltlich sind da Welten dazwischen.
Wie können wir in diesem Spannungsfeld sicherstellen, dass sich Menschen mit unterschiedlichen Bildungswegen und beruflichen Perspektiven nicht abgehängt fühlen?
Die deutsche Wirtschaft ist im Vergleich zu vielen anderen Volkswirtschaften recht stark auf mittelständische Unternehmen ausgerichtet. Und die brauchen primär Leute, die beruflich gut qualifiziert sind. Die müssen nicht unbedingt immer ein Abitur haben, aber sie müssen natürlich Grundfähigkeiten schulisch beigebracht bekommen. Also bestimmte Fähigkeiten, die die Voraussetzung sind, dass man dann eine gute berufliche Qualifikation hinkriegt. Das ist die Schwierigkeit, die zurzeit für manche fast schon utopisch ist.
An welche Qualifikationen denkst du da?
Mathematische Grundkenntnisse und eine gewisse Lesekompetenz. Das müssen keine hochkomplexen, anspruchsvollen Dinge sein, aber diese Grundfähigkeiten müssen gegeben sein. Die Stellen, die für Auszubildende angeboten werden, können oft nicht besetzt werden, weil viele Bewerber aus Sicht der Unternehmen ungeeignet sind. Insofern ist es wahrscheinlich ein Kernproblem für die nächsten Jahre, wo wir die Fachkräfte herbekommen.
Lücken entstehen durch demografische Probleme, Überalterung der Gesellschaft, geringe Geburtenzahl, aber natürlich auch dadurch, dass nicht alle Ressourcen ausgeschöpft werden können, wenn man die Leute im jugendlichen Alter nicht richtig ausbildet.
Eine Lösung ist es, durch Zuwanderung diese Lücken zu füllen. Aber das wird von vielen, die wirtschaftlich unzufrieden sind, als Bedrohung wahrgenommen. Dabei sind die Zahlen klar: Wir brauchen eine Netto-Zuwanderung von 400.000 Leuten pro Jahr.
Und dann gibt es aber Politiker, die Politik damit machen, die Grenzen zuzumachen.
Ja, das ist absurd. Die AfD-Politik läuft, wenn sie umgesetzt werden würde, darauf hinaus, dass genau die Bevölkerungsgruppe, die jetzt die AfD wählt, am Ende besonders beschissen dasteht. Völlig absurd. Von daher ist die Frage: Wie kann ich die Ressourcen aus der eigenen Bevölkerung nutzen? Wie kriege ich Leute aus bildungsfernen Familien so weit, dass sie einen vernünftigen Beruf erlernen können und von den Unternehmen akzeptiert werden? Es ist ein Riesenproblem.
Man kann Menschen alles beibringen, wenn sie Lust darauf haben, oder?
Naja, das ist für die Schulen auch eine Herausforderung. Es gibt Leute, die sich der schulischen Bildung entziehen wollen. Und an die kommt man ganz schwer ran. Und weil es heute ja auch um Demokratie geht: Wenn die Leute, vor allem Jugendliche, eine berufliche Perspektive haben und die dann auch noch gesellschaftlich akzeptiert ist, dann werden sie nicht mehr so anfällig sein für irgendwelche rechtsradikalen Vorstellungen. Da schließt sich der Kreis dann auch wieder.
Wenn man sich sicher ist mit seinem Beruf und seinem Umfeld, dann ist man nicht so anfällig für diesen ganzen Quatsch.
Wann hast du selbst das erste Mal bewusst wahrgenommen, wie wichtig Demokratie ist?
Ich denke, das fing in der Oberstufe an. Aus dieser Zeit ist mir eine Lehrkraft sehr stark in Erinnerung geblieben. Dieser eine Lehrer hat mit uns im Fach Deutsch sehr viele kritische Texte gelesen. Das war für mich der Beginn meiner bewussten politischen Sozialisation. Das hat sich dann natürlich durch die Universität noch weiter fortgesetzt. Ab 1970 habe ich Politikwissenschaft in Frankfurt studiert. Dabei an der gesamten Diskussion der damaligen Zeit vorbeizukommen, das war gar nicht denkbar. In gewissen Arbeitskreisen hatte ich dann Kontakt zu Leuten, mit denen ich ideologisch bisher noch nicht so konfrontiert wurde, marxistische Gruppen zum Beispiel. Das hat man alles so ein bisschen in sich aufgenommen und versucht, irgendwie zu verarbeiten und zu reflektieren. Aus heutiger Sicht würde ich natürlich sagen, dass mein Standpunkt damals wahrscheinlich etwas radikaler war, als er es heute ist.
Ich war auch auf einigen Demos, die für mich in eine Umbruchzeit fallen. Bei der Startbahn West stand ich zum Beispiel sehr zerrissen zwischen den Fronten. Auf der einen Seite habe ich das Problem gesehen, das damit verbunden war – Waldverlust und immer stärkere Zunahme des Flugverkehrs mit allen Problemen, die damit verbunden sind – aber auf der anderen Seite habe ich überlegt, wie die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland weitergehen kann und was diese wirtschaftliche Entwicklung für soziale Auswirkungen hat, darunter durchaus auch positive Wirkungen. Ich konnte die Argumente beider Seiten irgendwie nachvollziehen.
Wird denn genug über diese zwei Seiten der Medaille nachgedacht?
Diese Frage stellt sich für Teile der Bevölkerung so ja gar nicht. Es gibt da meistens zwei Punkte. Man kann hinterfragen, was brauche ich eigentlich wirklich und was ist ein überflüssiger Spaßfaktor? Und das andere ist die Überlegung, inwiefern ich über mein eigenes Bedürfnis hinaus konsumiere. Das muss man auch immer berücksichtigen.
Ich habe im Unterricht auch den Wirtschaftskreislauf und Sparen thematisiert. Da war gut ersichtlich, dass Sparen in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs für ungefähr die Hälfte der Bevölkerung gar keine Option ist, weil sie es nicht können. Es gibt ja schon Schwierigkeiten, in einem Ballungsraum wie hier überhaupt die Miete oder die Heizkosten zu bezahlen. Das ist das, was ich auch immer so als „Blasenproblem“ im Hinterkopf habe. Wir reden oft aus einer Situation heraus, wo diese existenziellen Aspekte für uns kaum eine Rolle spielen. Und das stellt sich aber für viele Leute ein bisschen anders dar, was natürlich dann auch dieses Ungerechtigkeitsgefühl bestärkt. Schon schwierig.
Ich glaube, der Schwerpunkt der AfD-Wähler beispielsweise liegt bei Leuten, die entweder wirtschaftlich oder sozial irgendwo abgehängt werden – oder zumindest Angst davor haben. Es ist nicht so, dass die jetzt alle am Hungertuch nagen, aber die Ängste existieren und diese Ängste sind wirtschaftlicher und kultureller Art.
Ich glaube, auch die Ängste vor Migration sind in vielen europäischen Ländern vorhanden. Das ist in Deutschland auch relativ ausgeprägt, gerade in AfD-Wählerkreisen, dass man immer Ängste hat, die anderen nehmen einem was weg. Man sollte einfach Kulturen kennenlernen, die eigene Bubble öffnen und verschiedene Meinungen einbeziehen.
Das Einbeziehen verschiedener Ansichten schafft unsere Demokratie ja recht gut. Was sind für dich Punkte, die du besonders an der Demokratie schätzt?
Ich würde in den Mittelpunkt stellen, dass wir das Prinzip der Konkordanzdemokratie haben. Unsere Demokratie baut auf einem konsensualen Charakter auf, anders als in den USA oder in anderen Ländern, wo man ein konkurrenzdemokratisches Modell hat. Das finde ich persönlich nicht so prickelnd.
Bei uns werden, wie du schon sagtest, auf verschiedenen Ebenen ganz unterschiedliche Standpunkte in den politischen Prozess eingebracht und in vielen Bereichen läuft es immer auf einen Konsens hinaus. Das fängt in den Parteien an, geht aber dann über die verschiedenen Gewaltenteilungsprozesse hinaus, also horizontal und vertikal. Es werden also politische Entscheidungen getroffen, die von der Mehrheit beschlossen werden. Das macht den politischen Prozess aber auch unheimlich zäh und führt dazu, dass viele rummeckern, weil es so lange dauert, bis etwas passiert. Man könnte in der Praxis sicher einige Prozesse massiv beschleunigen, ganz klar, aber das demokratische Grundprinzip läuft ja darauf hinaus, dass man versucht, möglichst viele Aspekte, Meinungen und Haltungen in den politischen Prozess zu integrieren und einzubeziehen, bevor es dann irgendwann zur Entscheidung kommt. Das ist mühsam, aber das gehört auch letztlich dazu, denke ich.
Wie kann Demokratie unter diesen Bedingungen widerstandsfähig bleiben und gleichzeitig Wege finden, um Vertrauen und Geduld in politische Prozesse zu stärken?
Wenn man die Frage stellt, wie man Lösungen findet, dann fußt das Ganze ja oft auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und auch diese Prozesse sind ja sehr mühsam. Das haben wir besonders vorgeführt bekommen zu Zeiten der Pandemie. Gerade da hat man gesehen, wie Wissenschaft funktioniert.
Ich denke, an solchen Beispielen kann man ganz gut sehen, dass gesellschaftliche Prozesse – und darauf aufbauend natürlich auch politische Entscheidungen – sehr mühsam sind. Wobei man natürlich irgendwann an einem Punkt angelangt ist, an dem die Wissenschaft Erkenntnisse liefert, die man nur noch sehr schwer anzweifeln kann. Also wenn wir an die Klimawandelproblematik denken, da zeigen 99,9 Prozent aller Erkenntnisse, dass er von Menschen gemacht oder zumindest stark forciert ist. Da kann man sich nicht mehr mit gutem Gewissen hinstellen und sagen, die Sonne spinnt einfach. Und das führt uns zu einem Problem: Wie informieren sich heute die Leute, vor allem die Jüngeren? Da kommen die sozialen Medien ins Spiel. Und da gehört es zur Aufgabe des Unterrichts, eine gewisse Medienkompetenz zu vermitteln, in der Oberstufe noch verstärkt. Wenn man irgendwelche Texte aus Medien im Unterricht behandelt, muss klar werden, ob das ein Bericht ist oder ein Kommentar und wie das gegenüber einem Sachverhalt einzuschätzen ist. Quasi eine Pro-Contra-Diskussion. Das sind Grundvoraussetzungen, die heute in sozialen Medien gar nicht mehr stattfinden.

Ist sowas angedacht vom Kultusministerium oder ist es jeder Lehrkraft selbst überlassen, den Unterricht zu gestalten?
Im Moment haben wir noch keinen Unterricht, der speziell Medienkunde beinhaltet. Wir haben Medien, politische Entwicklung und soziale Prozesse im Curriculum, da ist das natürlich schon drin, sodass das als Teil des demokratischen Prozesses mit einbezogen wird, aber das bleibt einem eigentlich selbst überlassen, wie man das macht. Die Schulbücher, die wir haben, die beinhalten oft noch keine Ausführungen zu sozialen Medien.
Du sagtest, dir ist diese eine Lehrkraft aus deiner Schulzeit so in Erinnerung geblieben. Versuchst du selbst ein Lehrer zu sein, der bei Schülerinnen und Schülern etwas bewegt, und gibst du auch selbst deine eigenen Meinungen in abgeschwächter Form an die Kids weiter?
Ja, das ist natürlich immer die Frage, gerade im Politikunterricht. Wenn ich etwas anderes unterrichte, Physik zum Beispiel, da spielt meine persönliche Meinung keine so große Rolle. Aber auch in Fächern wie Politik und Wirtschaft sollen wir als Lehrkräfte zwar keine Standpunkte vorgeben, aber ich finde, dass man als Lehrkraft auch irgendwo glaubwürdig bleiben muss. Die Schüler*innen müssen auch wissen, dass ich keine KI-gestützte Ausgabe für irgendwelche Lerninhalte bin, sondern eben auch als Mensch auftrete, der von seiner Person her glaubwürdig sein muss und natürlich auch Standpunkte hat.
Wissen neutral mitzugeben und dabei nicht aktiv die eigene Meinung mitzuteilen ist bestimmt nicht so leicht. Irgendwo schimmert die ja immer durch, oder?
Man muss trennen zwischen Inhalten, die man einfach vermitteln kann, und den eigenen Ansichten. Die Schülerschaft braucht Grundlagen, Handwerkszeug, um irgendwas beurteilen zu können. Das ist das eine. Das kann und sollte man natürlich vermitteln. Aber ich als Lehrkraft bin eben die Person, die ich bin, und ich habe gewisse Einstellungen zu den Themen, die ich vermittle.
Das passt zu dem, was du eben gesagt hast: Die Menschen müssen unterscheiden können, was ist ein Bericht und was ist ein Kommentar.
Das ist genau das. Ich muss klarstellen, was die Info oder die Theorie ist, die ich wiedergebe, und was meine Meinung oder mein Kommentar dazu ist. Das müssen die Schüler*innen dann lernen zu trennen. So sieht eben Medienkompetenz aus. Ich kann mich nicht so entpolitisieren, dass ich irgendwelche AfD-Standpunkte neutral rüberbringe. Es muss immer in dem demokratischen Spektrum bleiben, in dem Bereich, den uns das Grundgesetz vorgibt. Wenn eine Partei aus meiner Sicht diese Grenzen überschreitet und auch vom Verfassungsschutz schon als Verdachtsfall geführt wird und in Teilen sogar schon als rechtsradikal gekennzeichnet ist, dann muss ich mich da nicht zurückhalten und sagen: „Wir reden jetzt mal ganz neutral über die Standpunkte der AfD.“
Lehrer sein ist gar nicht so einfach, dachten wir uns aber schon.
Ich muss ja im Grunde genommen einfach nur klarstellen, mit welchen Argumenten ein Standpunkt vertreten wird, ich muss diesen Standpunkt aber nicht unbedingt teilen. Ich kann natürlich auch die Gegenstandpunkte anschauen und vergleichen, dann kann ich am Schluss auch begründen, warum ich etwas gut oder schlecht finde. Damit habe ich mich aber natürlich positioniert. Ich finde das auch legitim, weil die Schüler*innen natürlich auch den Anspruch haben, mich als greifbare Person mit Einstellungen und Meinungen zu sehen.
Ist der Lehrkraft-Schülerschaft-Umgang denn gleichgeblieben über all die Jahrzehnte? Gibt es mehr autoritäre Lehrer oder hat sich das Verhältnis entspannt?
Es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das bei Lehrern zu beurteilen. Also wir hatten hier an der Schule weniger diese klischeemäßigen Respektspersonen, glaube ich. Es hängt vielleicht damit zusammen, dass die CvSS ja erst vor vergleichsweise kurzer Zeit entstanden ist, im Vergleich zu anderen Schulen, die es seit Jahrhunderten schon gibt. Die Schule ist, als ich 1979 hierhergekommen bin, ein Jahr alt geworden. Und damals sind weitestgehend junge Lehrkräfte eingestellt worden. Deswegen gab es eine gewisse Homogenität ohne alte Traditionen, die dieses Autoritäre an manch anderen Schulen vielleicht noch verstärkt haben.
Ich kann als Lehrkraft Veränderungen eher auf Seiten der Schülerschaft beurteilen. Und da sehe ich schon gewisse Veränderungen im Lauf der Zeit. Wir hatten in den früheren Generationen, als ich hier an der Schule angefangen habe, eine relativ aufmüpfige Schülerschaft, was nicht unbedingt negativ gemeint ist. Das ist zurückgegangen. Aktuell ist unsere Schülerschaft in ihrer großen Mehrheit absolut umgänglich und verträglich. Das wirkt fast schon unglaublich.
Die Schüler*innen sind größtenteils total diszipliniert. Kurz vor dem Abi bröckelt das hinsichtlich der Fehlzeiten ein bisschen. Aber dass die in der elften Klasse schon so diszipliniert sind, das ist erstaunlich. Wenn ich mich mit Leuten aus meinem Umkreis unterhalte, fragen die: „Wieso bist du alter Knacker eigentlich immer noch im Unterricht?“. Dann erzähle ich, dass das hier an der Schule wie ein Sanatorium ist. Ich empfinde das wirklich so und ich mache das ja auch super gern. Ich kann mich mit den Inhalten und der Schülerschaft auseinandersetzen und das macht mir total Spaß. Deswegen mache ich es ja. Aber ja, das ist auch eine besondere Situation. Stichwort Blase – das ist hier halt auch wieder der Fall. Ich glaube, wenn ich an einer anderen Schule wäre, dann wäre das ein bisschen anders. Ich bin jetzt schon das zehnte Jahr in der Verlängerung mit dem Lehrer-Sein, da hab ich es lieber ein bisschen gesitteter.
Echt, 10 Jahre on top?
Ja, ich bin ja 75. Das hätte ich nicht gemacht, wenn ich jetzt dauernd noch irgendwelche pubertierenden Siebtklässler unterrichten müsste. Aber hier in der Oberstufe ist das schon eine besondere Situation.
Wow. Gibt’s eine Sache, die du in der ganzen Zeit gerne im Bildungssystem verändert hättest?
Das ist schwierig. Ich glaube, die Probleme im Bildungssektor fangen ganz woanders an und wir sollten uns grundsätzlich überlegen, warum es so viele bildungsferne Familien gibt. Solange es die in relativ großem Umfang gibt, ist da das Kernproblem, was sich einfach nur weiter in die Schulen verschiebt. Vorsichtig ausgedrückt: Das ist ein Problem, das ich gerne ändern würde.
Haben Schulen denn die Möglichkeit, noch rechtzeitig einzugreifen und was zu bewegen?
Die Schulen können wahrscheinlich auch nicht mehr unendlich viel machen, denn diese Art von sozialer Ungerechtigkeit manifestiert sich oft schon lange vor der Schulzeit in den Familien. Die Kinder haben teilweise nicht mal einen eigenen Schreibtisch, wo sie mal was machen können und der Fernseher dudelt den ganzen Tag im Hintergrund. Solche Situationen, dann auch noch auf beengtem Raum – wie sollen die Schüler da rauskommen? Da würde es sich anbieten, dass man eine Ganztagsschule hat. In so einem Umfeld könnte man einiges kompensieren, was zu Hause nicht läuft.
Aber wenn Kommunikation zu Hause merkwürdig abläuft, dann fehlen natürlich auch gewisse Grundlagen, die mit der sprachlichen Fähigkeit zu tun haben. Ich denke, dass die Beherrschung von Sprache die Grundvoraussetzung für jeden Schulerfolg ist. Letztlich für alles.
Wenn du in einem Satz erklären müsstest, warum Demokratie wichtig ist, was würdest du sagen?
Aus meiner Sicht, zumindest vom theoretischen Ansatz her, auch wenn der vielleicht nicht immer optimal umgesetzt wird: Demokratie ist wichtig, weil sie allen Mitgliedern einer Gesellschaft Teilhabe ermöglicht.
Was bedeutet das deiner Meinung nach für das Thema Migration?
Man muss wahrscheinlich Strukturen aufbrechen, die in manchen Kulturkreisen demokratiefern sind, ohne dass man jetzt versucht, die zu assimilieren. Die Sprachfähigkeit, die Kompetenz der deutschen Sprache, müsste für diejenigen, die dauer- oder längerfristig hierbleiben wollen, auf jeden Fall intensiviert werden. Das wäre ein Ansatz, wo der Staat viel Geld reinstecken müsste, um zumindest die nachfolgende Generation zu schulen, aber vielleicht auch schon die Eltern-Generation. Die Menschen sollen auf jeden Fall ihre kulturelle Identität bewahren, es führt aber kein Weg dran vorbei, dass sich diejenigen, die hier dauerhaft leben wollen, mit den Grundlagen unseres Systems und seinen demokratischen Werten auch identifizieren. Unterstellter mangelhafter Integrationswille wird aber als Aufhänger für ein rechtsradikales Narrativ genommen, das vorgibt, die demokratischen Werte schützen zu wollen. Dabei geht es nur um Machterlangung, um danach unsere Demokratie zu beschädigen und diese Werte zu missachten. Die tollen Chancen, die Migration aber auch bieten kann, werden zudem völlig negiert.
Was wäre die schlimmste Gefahr für unsere Demokratie, die du dir vorstellen kannst? Gibt es bei etwas, vor dem du Angst hast – einen Schwachpunkt in unserem System?
Ich hatte ganz am Anfang ja gesagt, dass ich vom Prinzip her eigentlich doch eher optimistisch bin. Ich gehe davon aus, dass ein Großteil unserer Bevölkerung eine gewisse Grundakzeptanz für das demokratische System besitzt, weil wir nicht so krasse soziale Gegensätze haben wie in den USA. Und solange das so ist, sehe ich nicht, dass sich die Demokratie schnell aushebeln lässt. Also insofern vertraue ich auf unsere Werte.
Gibt es ein Buch, eine Doku oder irgendwas, was du Menschen besonders ans Herz legen würdest, um Demokratie besser zu verstehen?
Eine konkrete Empfehlung habe ich nicht. Es sind viele Einzelaspekte, die dazu beitragen könnten, ein Grundverständnis für Demokratie zu bekommen.
Man kann sich ansehen, was schieflaufen kann, wie beispielsweise jetzt in den USA. Wenn man die Nachrichten verfolgt, Artikel liest und Statistiken betrachtet, dann erklärt sich auch manches. Und dann kann man natürlich auch sehen, was schiefläuft und wie Demokratie eigentlich funktionieren sollte.
Oder man besucht einfach deinen Unterricht an der CvSS. Aber mal Kompliment: 75, wow! Hätte ich nicht gedacht.
Ja, ich habe lange durchgehalten. Nee, was heißt durchgehalten? Das macht mir Spaß! Ich glaube, daran liegt es auch ein bisschen. Das ist der einfache Trick, glaube ich.
So positiv beenden wir doch gerne unsere Interviews! Vielen Dank.
Interview:
Chrissy Kalla
Frank Krupka
Fotos:
Andrea Krupka